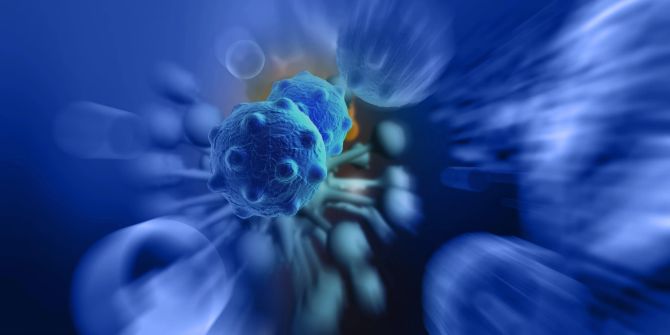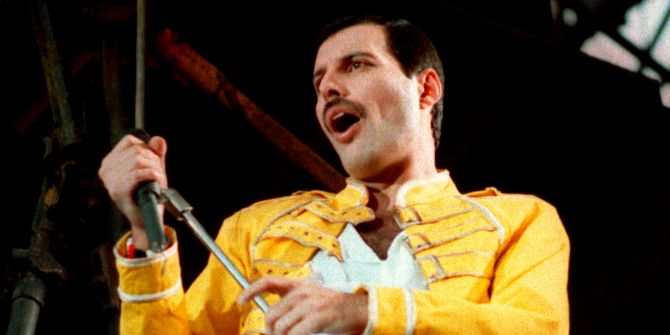Wie Krebs gesunde Zellen für sich arbeiten lässt
Ein Forschungsteam der ETH Zürich zeigt, dass Krebszellen benachbarte Zellen gezielt so manipulieren können, dass sie das Tumorwachstum unterstützen.
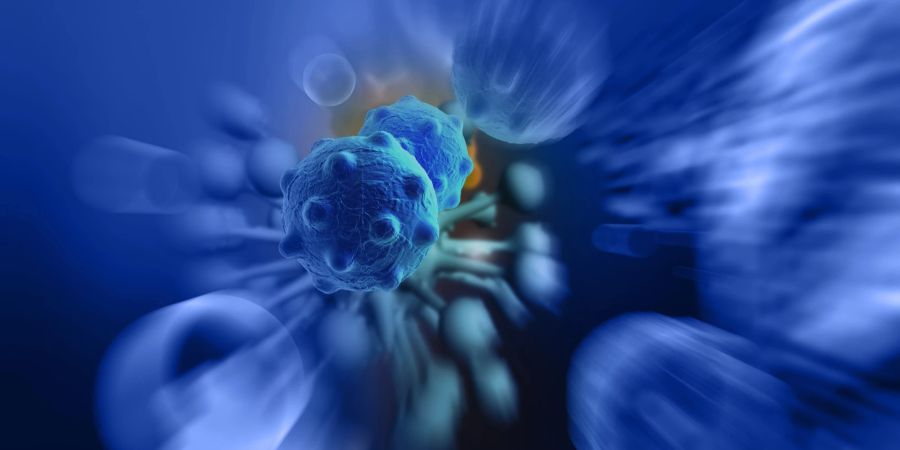
Krebszellen manipulieren Nachbarzellen für ihre eigenen Zwecke. Wie ein Forschungsteam der ETH Zürich herausgefunden hat, können sie benachbarte Zellen so umprogrammieren, dass diese dem Tumor beim Wachsen helfen.
«Die Krebszellen nutzen eigentlich einen bei Verletzungen vorteilhaften Mechanismus für ihre Zwecke aus. Damit können sie zu einem bösartigen Tumor auswachsen», erklärte Studienleiterin Sabine Werner in einer Mitteilung der ETH Zürich am Freitag.
Hautkrebszellen geben dazu ihre «Energiekraftwerke» – die Mitochondrien – an gesunde Zellen weiter. Diese beginnen dann, mehr Energie und Wachstumsstoffe zu produzieren, die den Tumor schneller wachsen lassen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Nature Cancer» veröffentlicht.
Dass Zellen über solche Verbindungen Mitochondrien austauschen können, war bereits bekannt. Normalerweise dient dieser Mechanismus jedoch der Heilung: So wurde etwa gezeigt, dass nach einem Schlaganfall gesunde Nervenzellen ihre Mitochondrien an geschädigte Zellen weitergeben, um deren Überleben zu sichern.
Mitochondrien-Transfer wohl auch bei anderen Krebsarten relevant
In Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsgruppen an der ETH Zürich fanden die Forschenden Hinweise darauf, dass dieser Mitochondrien-Transfer auch bei anderen Krebsarten eine Rolle spielt, etwa bei Brustkrebs und bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Für das Einschleusen der Mitochondrien nutzen die Krebszellen das Protein MIRO2, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter berichten.
Die neuen Erkenntnisse bieten laut den Forschenden Ansatzpunkte für mögliche Therapien. Könnte dieses Protein blockiert werden, würde der Mitochondrien-Transfer wohl nicht mehr funktionieren. «Im Reagenzglas und im Mausmodell funktionierte die MIRO2-Blockade.
Ob es im menschlichen Gewebe auch klappt, ist noch unerforscht», sagte Werner. Gelingt dies, könnte laut der Forscherin daraus längerfristig eine neue Behandlung entstehen. Bis dahin dürften aber noch Jahre vergehen.