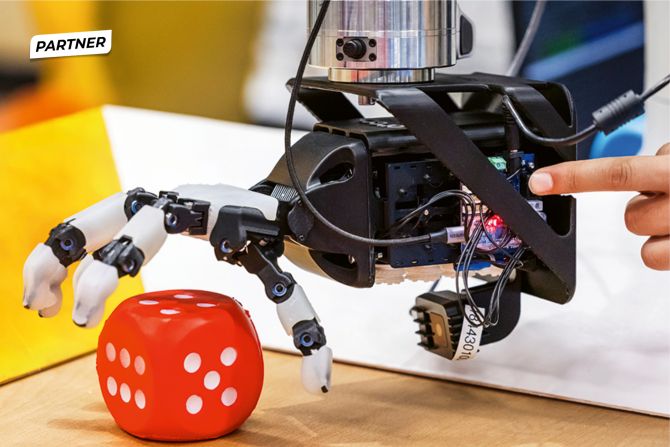Schweizer Technologie: Carsharing-Autos als Stromspeicher
Ein Forschungsprojekt zeigt, wie Elektroautos im Carsharing künftig Strom speichern und zurückspeisen können.

Das Wichtigste in Kürze
- FHNW und OST testen bidirektionales Laden mit Mobility-Fahrzeugen.
- Die Autos können in bis zu 60 Prozent der Fälle Netzbelastungen verringern.
- Das Modell lässt sich einfach in bestehende Stromnetze integrieren.
Elektroautos könnten künftig mehr leisten als bloss umweltfreundlich fahren: Sie könnten das Stromnetz stabilisieren. Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Ostschweizer Fachhochschule (OST) zeigt, dass Carsharing-Fahrzeuge als mobile Stromspeicher einen echten Beitrag zur Energiewende leisten können. Beteiligt waren auch die Energieversorger AEM, EWZ und Primeo Energie sowie die Mobility-Genossenschaft.
Das Projekt untersuchte, wie das sogenannte bidirektionale Laden – also das Laden und Entladen von Batterien – in der Praxis funktioniert. Die Idee: Elektroautos laden Strom, wenn er im Überfluss vorhanden ist, und speisen ihn zurück, wenn viel Strom gebraucht wird.
Die Forschenden testeten das Prinzip in mehreren Feldversuchen. Mobility-Fahrzeuge verschoben ihre Ladezeiten automatisch in Zeiten mit Stromüberschuss und gaben in Spitzenzeiten Energie zurück ins lokale Verteilnetz. Das Ergebnis war beeindruckend: In bis zu 60 Prozent der Fälle liess sich die Netzbelastung messbar senken. Besonders bei hoher Nachfrage oder grosser Solarstromproduktion half die intelligente Steuerung, das Netz im Gleichgewicht zu halten.
Genügend Kapazität, um Schwankungen auszugleichen
Damit das funktioniert, braucht es clevere Prognosen. Hier kam künstliche Intelligenz ins Spiel: Algorithmen sagten anhand von Millionen Buchungsdaten voraus, wann und wie lange Autos verfügbar sind. Zudem wurden Batteriedaten analysiert, um zu bestimmen, wie viel Energie gespeichert oder abgegeben werden kann. Pro Fahrzeug standen durchschnittlich 9 bis 12 Kilowattstunden zur Verfügung – genug, um lokale Schwankungen effektiv auszugleichen.
Ein weiterer Erfolg des Projekts ist ein standardisierbares Produktmodell, das den Energieversorgern die Integration erleichtert. Es konzentriert sich auf zwei Hauptanwendungen: das Laden bei Stromüberschuss – etwa, wenn viel Solarstrom produziert wird – und die Rückspeisung bei Netzlastspitzen, wenn der Bedarf besonders hoch ist.
Die Steuerung kann über bestehende Systeme erfolgen, vom klassischen Rundsteuergerät bis zu modernen digitalen Plattformen. Das Modell sieht zudem eine Vergütung für bereitgestellte und genutzte Ladekapazität vor – im Viertelstundenraster, abgestimmt auf den tatsächlichen Netzbedarf.
Das Fazit der Forschenden: Elektroautos sind mehr als nur Verkehrsmittel. Sie können zu einem wichtigen Baustein einer klimafreundlichen, dezentralen Energiezukunft werden. Für Energieversorger bedeutet das stabilere Netze und geringere Kosten. Für Carsharing-Anbieter wie Mobility eröffnet es neue Geschäftsmodelle – und für die Gesellschaft einen Schritt näher an eine nachhaltige Energiewirtschaft.