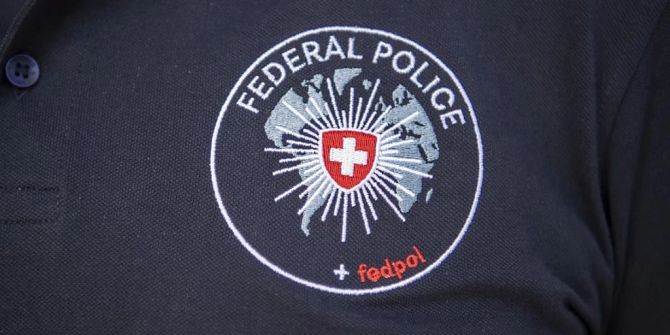Sellner-Einreiseverbot: Fedpol-Chefin überstimmte Mitarbeiter
Gegen die Einschätzung mehrerer Bundesstellen wurde ein Einreiseverbot gegen den Rechtsextremisten verhängt. An diesem Verfahren übt der Ständerat nun Kritik.

Das Wichtigste in Kürze
- Martin Sellner wurde 2024 wegen eines Einreiseverbots festgenommen und ausgewiesen.
- Die damalige Fedpol-Direktorin della Valle setzte sich über interne Einschätzungen hinweg.
- Die Ständeratskommission kritisiert fehlende Dokumentation und unklare Zuständigkeiten.
Rechtsextremist Martin Sellner wollte Ende 2024 auf Einladung der Gruppe Junge Tat im Kanton Zürich einen Vortrag über «Remigration» halten. Doch ein kurzfristig verhängtes Einreiseverbot verhinderte den Auftritt des Österreichers.
Als Sellner am Veranstaltungstag trotzdem in Kreuzlingen einreiste, wurde er festgenommen und aus der Schweiz ausgewiesen.
Sicherheitsbehörden sahen zunächst keinen Grund für Verbot
Wie jetzt «CH Media» berichtet, verlief der Entscheidungsprozess zum Einreiseverbot ungewöhnlich. Demnach hatten Staatssekretariat für Migration, Fedpol und Nachrichtendienst zunächst entschieden, dass keine rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot vorlagen.
Erst auf Intervention des Zürcher Polizeikommandanten hin griff die damalige Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ein. Entgegen der Einschätzungen ordnete sie ein Einreiseverbot an.
Della Valle begründete ihren Entschluss mit einer «breiteren Perspektive». Zudem äusserte sie den Vorwurf, die zuständige Abteilung blende die Realitäten in den betroffenen Kantonen häufig aus. Das geht aus einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Ständerats hervor.
Ständeratskommission kritisiert fehlende Transparenz
Die Kommission kritisiert den gesamten Ablauf scharf. Entscheidkompetenzen seien nicht klar geregelt und wesentliche Verfahrensschritte nicht dokumentiert worden. Der Entscheid, das ursprüngliche Nein zum Verbot zu übersteuern, sei nicht nachvollziehbar.
Die Ständeräte bemängeln insbesondere Zeitpunkt und Art des Eingreifens der Direktorin und sehen den Verdacht «möglicherweise politisch motivierter Einflussnahme». Auch ein weiterer Fall vom Januar 2025 weise ähnliche Mängel auf.