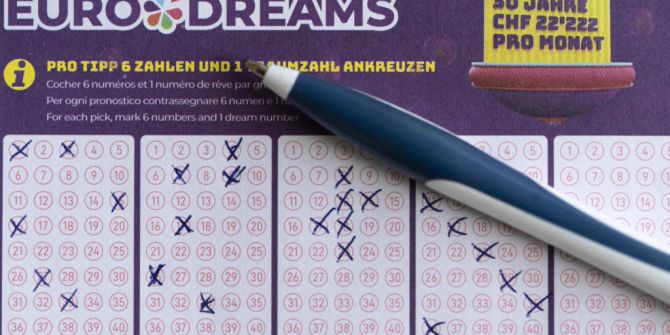Ex-FBI-Chef Comey plädiert auf nicht schuldig
James Comey, Ex-FBI-Chef, hat vor dem Bundesgericht in Alexandria betont, er sei nicht schuldig. Er muss sich wegen angeblicher Falschaussagen behaupten.

Ex-FBI-Chef James Comey trat am Mittwoch vor das Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia. Sein Rechtsanwalt Patrick Fitzgerald erklärte im Namen seines Mandanten das Plädoyer «nicht schuldig» zu allen erhobenen Anklagepunkten.
Das Gericht terminierte den Prozessbeginn auf den 5. Januar des kommenden Jahres. Comey wurde von mehreren Familienmitgliedern begleitet, die ihm während des Gerichtstermins zur Seite standen.
Seine Tochter Maurene, die zuvor als Bundesanwältin in New York gearbeitet hatte, war unter den Anwesenden, so «ZDFHeute». Bemerkenswert war die Anwesenheit seines Schwiegersohns Troy Edwards Jr., der kurz nach der Anklageerhebung seinen Posten als Staatsanwalt aufgegeben hatte.
Unterstützer betonen: Ex-FBI-Chef ist nicht schuldig
Bereits vor Comeys Ankunft hatten sich dem «Spiegel» zufolge zahlreiche Unterstützer vor dem Justizgebäude eingefunden. Die Demonstranten hielten Schilder mit eindeutigen Botschaften hoch, die das Verfahren als «Schauprozess» und «Unterdrückung der Opposition» bezeichneten.

Die Versammlung unterstrich die gesellschaftliche Polarisierung, die dieser Fall ausgelöst hat. Viele der Anwesenden äusserten ihre Überzeugung, dass hier politische Vergeltung statt echter Rechtsprechung stattfinde.
Details der strafrechtlichen Vorwürfe – Comey droht mehrjährige Haftstrafe
Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Comey, im September 2020 vor dem Justizausschuss des Senats unwahre Aussagen getätigt zu haben, so «ZDFHeute». Zusätzlich wird ihm vorgeworfen, eine parlamentarische Untersuchung behindert und vertrauliche Informationen unrechtmässig preisgegeben zu haben.
Im Falle einer Verurteilung könnte Comey eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren erwarten. Das Justizministerium hatte die Anklage nur wenige Tage nach öffentlichen Äusserungen von Präsident Trump erhoben.

Trump hatte das von Pam Bondi geleitete Ministerium explizit dazu aufgerufen, gegen Comey und andere Kritiker vorzugehen. Diese zeitliche Nähe verstärkt die Spekulationen über politische Motive hinter der Strafverfolgung.
Befürchtungen über Justizmissbrauch
Juristen und Verfassungsexperten warnen vor einer zunehmenden Politisierung der amerikanischen Rechtsprechung. Das Comey-Verfahren sei ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung politischer Widersacher instrumentalisiert werden.
Comeys Verteidiger werden voraussichtlich argumentieren, dass es sich um eine politisch motivierte Verfolgung handelt. Trumps öffentliche Äusserungen, in denen er bestritt, dass es um Rache gehe, könnten als Beweis für genau diese Motivation dienen.
Comey vs. Trump: Wurzeln des Konflikts in der Russland-Affäre
Die Feindseligkeit zwischen Trump und Comey entstand 2016 während der Untersuchungen zur russischen Wahlbeeinflussung. Comey leitete damals als FBI-Chef die Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampf und russischen Geheimdiensten.

Diese brisanten Untersuchungen führten schliesslich zu Comeys Entlassung. Obama hatte Comey laut der «Zeit» zum Direktor der Bundespolizei berufen.
Seine kompromisslose Haltung bei den Russland-Ermittlungen machte ihn zu einem der prominentesten Trump-Kritiker.