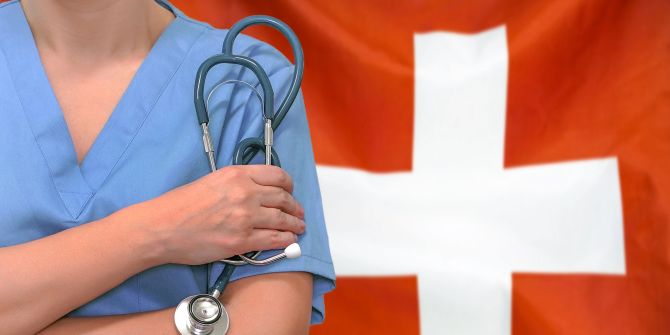Arbeit, aber fair: Warum Lohntransparenz so wichtig ist
Gleiches Geld für gleiche Arbeit? Ohne Lohntransparenz lässt sich nicht feststellen, ob diese eigentlich gesetzlich verankerten Grundsätze eingehalten werden.

Das Wichtigste in Kürze
- Der Gender Pay Gap lag in der Schweiz 2024 noch immer bei 16 Prozent.
- Seit 2020 müssen grosse Unternehmen eine Lohngleichstellungsanalyse durchführen.
Der eine arbeitet körperlich hart und das Geld reicht trotzdem kaum für das Nötigste. Der andere verdient am Schreibtisch sitzend in einem Jahr mehr als andere im ganzen Arbeitsleben. Gehälter können je nach Beruf sehr unterschiedlich sein.
Tabuthema Lohn in der Schweiz
In manchen Fällen sind hohe Löhne durchaus gerechtfertigt. Sie gehen oft mit hoher Qualifikation, Spezialisierung und oft auch mit viel Verantwortung ein. In anderen Fällen ist die Lage jedoch weniger eindeutig. Mangelnde Lohntransparenz führt dazu, dass viele Menschen gar nicht wissen, was andere in ähnlichen Positionen verdienen.

Das Bundesamt für Statistik berichtete, dass der Medianlohn im Jahr 2022 bei 6788 Franken lag. Allerdings sind die Lohnunterschiede zwischen den Branchen enorm.
So werden in der Pharmaindustrie durchschnittliche Löhne von 10'296 Franken und bei Banken von 10'491 Franken gezahlt. Im Gastgewerbe sind es dagegen nur 4601 Franken und in der Hotellerie 4572 Franken.
Löhne sind in der Schweiz allerdings noch immer ein Tabuthema. Kolleginnen und Kollegen vergleichen ihre Gehälter kaum miteinander, was dazu führt, dass Mitarbeitende trotz gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Ein Dauerthema ist der Gender Pay Gap, also der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern.
Arbeit: Mit Lohntransparenz gegen den Gender Pay Gap
Aktuellen Zahlen des Bundes zufolge sinken die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen allmählich. Verdienten Frauen im Jahr 2012 noch 19 Prozent weniger als Männer, waren es im Jahr 2022 noch 16 Prozent.
Diese Unterschiede lassen sich teilweise erklären: So streben Männer beispielsweise häufiger eine Karriere an, die zu Beförderungen und höheren Löhnen führt. Frauen arbeiten dagegen öfter in schlechter bezahlten Branchen und in Teilzeit.

Doch zunehmende Lohntransparenz hat gezeigt, dass Frauen auch bei exakt gleichen Tätigkeiten oft weniger verdienen. Eindeutige Erklärungen dafür gibt es nicht. Einige vermuten, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen weniger selbstsicher auftreten. Andere befürchten, dass ihnen familienbedingte Auszeiten angekreidet werden, die zu längeren Pausen von der Arbeit führen.
Lohngleichheitsanalyse soll Arbeit fairer belohnen
Dies läuft dem Gleichstellungsgesetz der Schweiz sowie dem Diskriminierungsverbot zuwider. Seit Juli 2020 sind Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten immerhin dazu verpflichtet, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen.
Davon profitieren nicht nur Frauen, sondern auch andere Gruppen, die häufig Diskriminierung erfahren: Dazu zählen beispielsweise ausländische Arbeitskräfte, die oft gar nicht wissen, welche Löhne für sie möglich wären.

In diesem Bereich hat das Internet bereits zu grossen Fortschritten geführt. Heute lassen sich für die meisten Berufe zumindest Lohnspannen abrufen, die sich nach Kantonen und Städten unterteilen lassen.
Arbeit: Unternehmen profitieren ebenfalls von Lohntransparenz
Es sind jedoch nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von höherer Lohntransparenz profitieren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Unternehmen von einem offensiven Umgang mit dem Thema Geld profitieren.
Eine Umfrage von Jobs.ch ergab, dass nur in 11,8 Prozent der Stellenanzeigen das Gehalt erwähnt wird. Dabei wünschen sich 46 Prozent der Generation Z genau diese Angabe.

Mehr Transparenz ist auch für Unternehmen von Vorteil: Faire Löhne motivieren gut qualifizierte Menschen, sich zu bewerben.
Denn: Personen, die zu diesem Lohn nicht arbeiten wollen, bewerben sich erst gar nicht. Dies spart auf beiden Seiten viel Zeit. Bewerbungsgespräche sind zum Scheitern verurteilt, wenn sich Arbeitgeber und Bewerber beim Gehalt nicht einigen können.