Meilensteine in den schweizerisch-chinesischen Beziehungen
Seit Jahrzehnten vertiefen die Schweiz und China ihre Wirtschaftsbeziehungen – immer wieder überschattet von Spannungen wegen Menschenrechtsfragen.
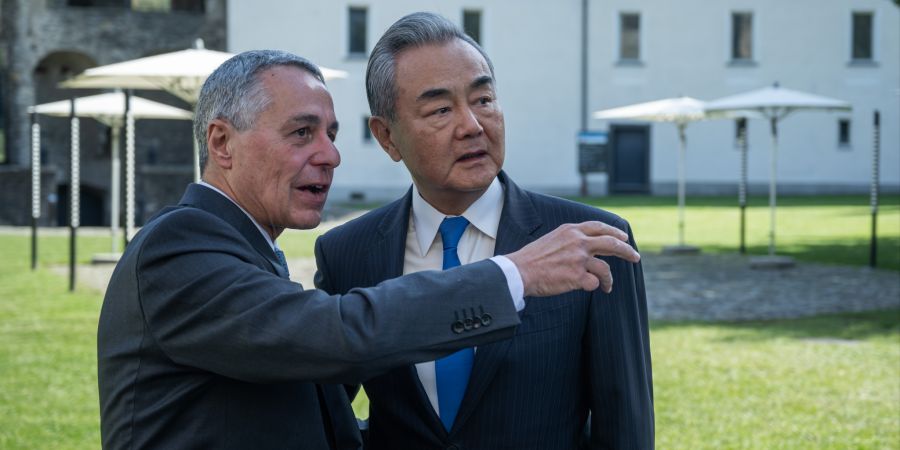
Der Handel zwischen der Schweiz und China ist in den vergangenen Jahrzehnten rasch gewachsen. Der Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen standen jedoch immer wieder Spannungen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber.
- Im Januar 1950 anerkennt die Schweiz die Volksrepublik China an. Von den westlichen Staaten machen nur Grossbritannien und die skandinavischen Staaten ähnlich früh diesen Schritt. Die meisten Staaten des Westens folgen dem Beispiel der USA und erhalten zunächst die Beziehungen zur nach dem chinesischen Bürgerkrieg nach Taiwan geflüchteten nationalchinesischen Regierung aufrecht.
- 1974: Aussenminister Pierre Graber führt die erste Schweizer Wirtschaftsmission nach China. Nach Beginn der Wirtschaftsreformen Deng Xiaopings Ende der 1970er-Jahre gewinnen die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern rasch an Bedeutung.
- 1991 vereinbaren die Schweiz und China einen jährlichen Menschenrechtsdialog.
Von Protesten zu Freihandel
- März 1999: Beim Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs Jiang Zemin in Bern kommt es zum Eklat. Beim offiziellen Empfang vor dem Bundeshaus klettern Exil-Tibeter auf die Dächer rund um das Bundeshaus. Sie schwenken Fahnen und Plakate, auf denen «Free Tibet» zu lesen ist. Erzürnt lässt Jiang Zemin den Empfang platzen und marschiert schnurstracks ins Bundeshaus. Die damalige Bundespräsidentin Ruth Dreifuss lässt er wissen: «Sie haben einen guten Freund verloren.»
- Juli 2013: Bundesrat Johann Schneider-Ammann unterzeichnet in Peking das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Volksrepublik China. Nach Island ist die Schweiz erst das zweite Land in Europa, das mit China ein solches Abkommen schliesst. Schon seit 2010 ist die Volksrepublik China der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Asien und der drittwichtigste Handelspartner überhaupt hinter der EU und den USA.
- Januar 2017: Erstmals seit 1999 besucht mit Xi Jinping ein chinesischer Staatschef die Schweiz. Bern und Peking unterzeichnen eine Reihe von Abkommen und Vereinbarungen. Die zweitägige Visite ist begleitet von Protesten von Exil-Tibetern, zum Eklat kommt es diesmal aber nicht.
Diplomatie unter Druck
- 2019: Die Schweiz unterzeichnet einen Brief an die Uno mit, in dem die Schliessung von sogenannten «Umerziehungslagern» für Angehörige der uigurischen Minderheit in der Region Xinjiang gefordert wird. China sagt daraufhin die Gespräche zum Menschenrechtsdialog ab. Erst 2023 wird dieser Dialog wieder aufgenommen.
- März 2020: Als Zweitrat stimmt der Nationalrat einer Motion zur Einführung staatlicher Investitionskontrollen zu. Die Umsetzungsvorlage ist im Oktober 2025 noch immer im Parlament hängig. Auslöser für die Arbeiten an dem Gesetzesprojekt war unter anderem die Übernahme des Schweizer Agrochemie-Riesen Syngenta durch den Staatskonzern Chem China im Juni 2017 . Das Projekt wird deshalb auch «Lex China» genannt.
Von China-Strategie bis Freihandel
- März 2021: Der Bundesrat präsentiert die erste China-Strategie der Schweiz. Er setzt dabei nach eigener Aussage auf einen konstruktiv-kritischen Dialog – auch zu den Menschenrechten. Pekings Botschafter in Bern wirft der Schweiz daraufhin Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas vor.
- Dezember 2022: Der Bundesrat entscheidet, die von der EU wegen der Unterdrückung der uigurischen Minderheit gegen China verhängten Sanktionen nicht zu übernehmen. Publik wird der Entscheid erst im Oktober 2023 durch einen Bericht der «NZZ am Sonntag».
- Januar 2024: Der damalige chinesische Premierminister Li Qiang besucht das Weltwirtschaftsforum in Davos GR – und stattet auch Bundespräsidentin Viola Amherd einen offiziellen Besuch ab. Die beiden Staaten vereinbaren, Verhandlungen zur Modernisierung des Freihandelsabkommens aufzunehmen.










