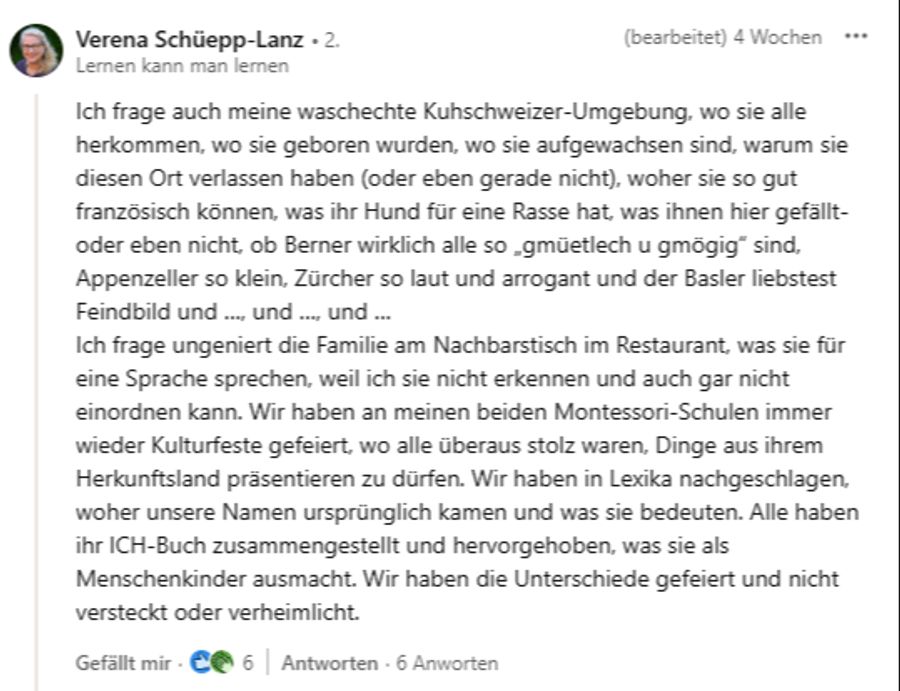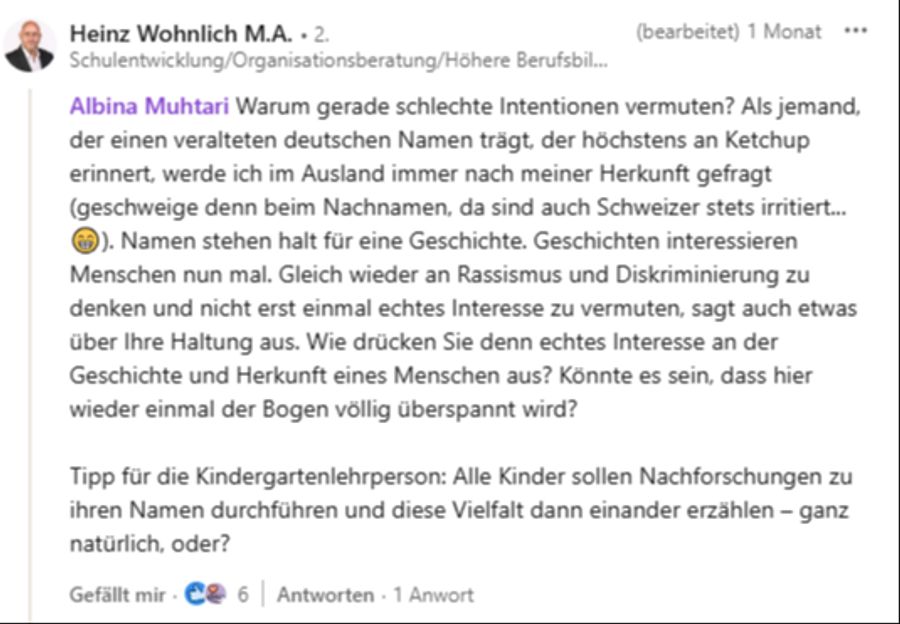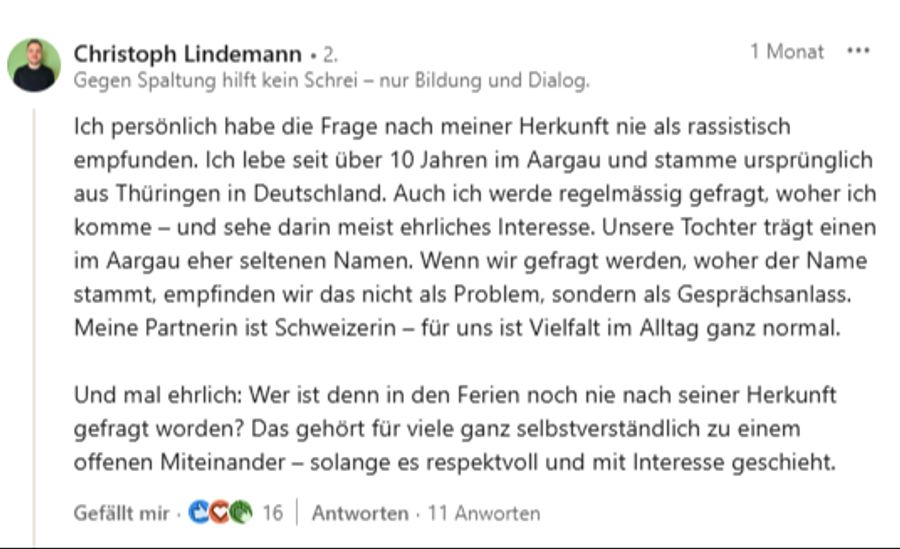«Woher der Name?»: Diese Lehrer-Frage könnte «fatale» Folgen haben
Eine Kindergärtnerin fragte eine Vierjährige, ob ihr Name albanisch sei. Solche Fragen will deren Mutter «endlich aus dem Vokabular verbannen».

Das Wichtigste in Kürze
- Am Besuchstag fragte die Kindergärtnerin Albina Muhtaris Tochter nach der Namensherkunft.
- Die Mutter und «Baba News»-Chefredaktorin bezeichnet die Folgen dieser Frage als fatal.
- Sie frage auch ihre «Kuhschweizer-Umgebung» nach der Herkunft, sagt eine Kindergärtnerin.
Der «Bsüechli-Tag» in einem Berner Kindergarten hinterlässt bei Albina Muhtari einen bitteren Nachgeschmack. Grund dafür ist eine Frage der künftigen Kindergartenlehrerin ihrer Tochter. Diese wollte wissen, ob ihr Name albanisch sei.
Die Tochter kam mit derselben Frage nach Hause. Sie habe einfach Ja gesagt, erzählt sie der Mutter. Dies schildert Albina Muhtari im Online-Magazin «Baba News», dessen Chefredaktorin sie auch ist.
«Dass es hier nicht um Namensforschung an sich geht, liegt auf der Hand», kritisiert Muhtari, die balkanische Wurzeln hat. Sie zieht den Vergleich zum «Nachbarsmädchen Elena Johanna Müller».
Von diesem erwarte niemand, mit vier Jahren eine onomastische Herleitung ihres griechisch-hebräischen Vornamens zu liefern. Unter Onomastik versteht man die Namenkunde.
«Frisst ein Loch ins Urvertrauen»
Sie ist überzeugt, dass es nicht um Neugier an Sprache oder Geschichte gehe. Stattdessen stehe die Herkunft im Zentrum. «Sprich: wer ‹von hier› ist und wer nicht.»
Die Folgen dieser Frage bezeichnet Muhtari als «fatal».
«Die Frage frisst oft ein Loch ins Urvertrauen», schreibt Muhtari. Auch schaffe sie ein brüchiges und ambivalentes Verhältnis zur Gesellschaft. «Sie schafft Distanz, Selbstzweifel und Misstrauen.»
Die Rede ist vom sogenannten «Othering». Dieser Prozess konstruiert Menschen als «Andere» und unterscheidet sie von einem «Wir».
«Unterschiede gefeiert»
Auch in einem Linkedin-Post kritisiert Muhtari das Verhalten. Lehr- und Betreuungspersonen sollten diese Frage «endlich (!) aus ihrem Vokabular verbannen», fordert sie.
Zudem wünscht sie sich, dass Anti-Rassismus-Fachstellen Lehrpersonen stärker für solche Fragen sensibilisieren.
Mit dem Post hat Muhtari eine grosse Diskussion ausgelöst.
Sie frage auch ihre «waschechte Kuhschweizer-Umgebung», wo sie alle herkämen, schreibt Verena Schüepp-Lanz auf Linkedin. Sie ist Kindergärtnerin und Montessori-Pädagogin.
An den Kulturfesten der Montessori-Schule seien alle überaus stolz gewesen, Dinge aus ihrem Herkunftsland präsentieren zu dürfen. «Wir haben die Unterschiede gefeiert und nicht versteckt oder verheimlicht.»
«Werde immer nach meiner Herkunft gefragt»
Heinz Wohnlich versteht nicht, warum mit der Frage nach der Namensherkunft schlechte Absichten vermutet werden.
Er trage einen veralteten deutschen Namen, «der höchstens an Ketchup erinnert», schreibt er ebenfalls auf Linkedin. «Im Ausland werde ich immer nach meiner Herkunft gefragt.»
Erst recht sei dies bei seinem Nachnamen der Fall. «Da sind auch Schweizer stets irritiert.» Namen stünden halt für eine Geschichte. «Geschichten interessieren Menschen nun mal.»
«Nie als rassistisch empfunden»
Auch Christoph Lindemann fragen Leute regelmässig nach seiner Herkunft. Er lebe seit über zehn Jahren im Aargau und stamme ursprünglich aus Thüringen in Deutschland, schreibt er. «Ich persönlich habe die Frage nach meiner Herkunft nie als rassistisch empfunden.»
Die Tochter trage einen im Aargau eher seltenen Namen, so Lindemann. Die Frage nach der Herkunft des Namens empfänden er und seine Frau nicht als Problem. Stattdessen sähen sie darin einen Gesprächsanlass.
Benj Kern, Betreuungsleiter in Winterthur, stellt fest, dass Rassismus in unserer Gesellschaft tief verwurzelt sei.
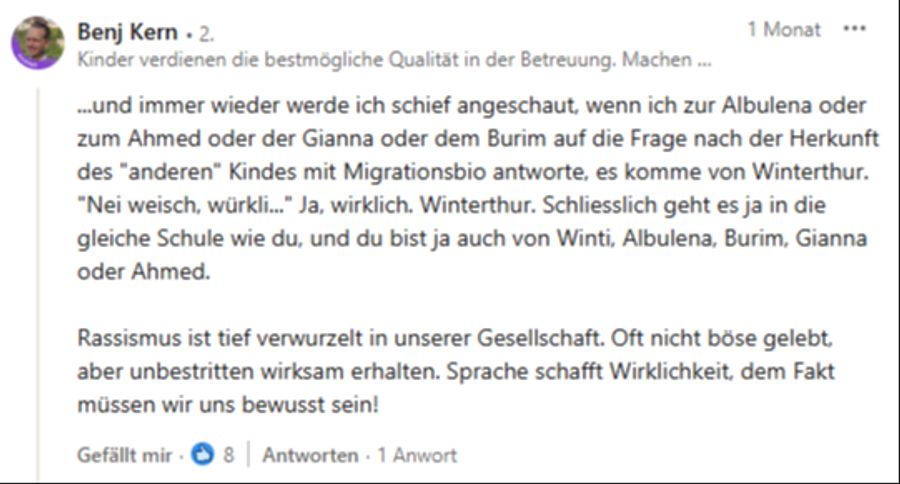
Fragt ihn jemand nach der Herkunft des «anderen» Kindes mit Migrationsbiografie, antwortet er jeweils «Winterthur». Dabei werde er immer wieder schief angeschaut, schreibt er auf Linkedin.
«Nei weisch, würkli ...», fragten die Leute, so Kern. «Ja, wirklich. Winterthur», antworte er dann.
Persönliches Interesse sei der Grund
Ob Albina Muhtari bei der künftigen Kindergärtnerin ihrer Tochter vorstellig geworden ist, ist unklar. Die Chefredaktorin will sich auf Anfrage dazu nicht weiter äussern.
Fragen nach der Herkunft können in Kindergärten und Schulen auftauchen.
In der Regel fragten Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler nicht nach ihrer Herkunft, sagt Dagmar Rösler. Sie ist Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH).
«Sicher kann es aber vorkommen, dass man in einem Gespräch auf dieses Thema kommt.» Grund dafür sei das persönliche Interesse. «Und nicht, weil man eine ‹Einordnung› oder Othering machen will.»
Es brauche noch mehr Sensibilisierung
In Klassen gibt es laut Rösler heute viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturen. «Da reden dann die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen von sich aus über ihre Herkunft.» Auch zeigten sie Interesse aneinander.
«Ich kann die Gefühle von Frau Muhtari verstehen und respektiere sie auch», sagt die Präsidentin.
Es brauche sicher noch mehr Sensibilisierung und Auseinandersetzung mit dem Thema. «Ich bin aber ganz sicher, dass die Kindergartenlehrperson weit weg war von Ausgrenzung, Rassimus, etc.»
«Du bist anders»
Dr. Ilona Pap, Migrationssoziologin an der Universität Zürich, erachtet das Thema als wichtig. «Die Frage nach der Herkunft des Namens kann das Signal senden: ‹Du bist anders›», sagt Pap. Besonders dann, wenn sie sich nur an bestimmte Kinder richte, die aufgrund bestimmter Merkmale hervorgehoben würden.
Solche Signale wirken laut Pap nicht nur auf das betroffene Kind, sondern auf die gesamte Klasse. «Sie prägen, was als ‹normal› gilt, und beeinflussen die Identitätsentwicklung aller Kinder im Raum.»
Die Migrationssoziologin hat Daten zu Personen mit Migrationsgeschichte in der Schweiz erhoben. Diese zeigen einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Diskriminierung und Identifikation mit der Schweiz. «Wer sich häufig aufgrund seiner Herkunft benachteiligt fühlt, identifiziert sich in der Regel weniger stark mit der Schweiz.»
Auch macht sie darauf aufmerksam, dass nicht alle Kinder sich selbst mit der Migrationsgeschichte ihrer Familie identifizierten.
Viele Kinder seien hier geboren, sprächen Schweizerdeutsch und erlebten die Schweiz als ihre Heimat. «Die Frage nach der Herkunft kann eine Identität aufzwingen, die nicht aus eigener Erfahrung, sondern von aussen zugeschrieben wird.»
Multikulturelle Schulprojekte
Im Rahmen eines Projekts begrüssen sich die Schülerinnen und Schüler jeden Morgen in der Landessprache eines Kindes. An einer anderen Schule bringen Kinder für einen «interkulturellen Zmorge» ein Frühstück aus ihrem Land mit.
Mit diesen Beispielen kritisiert Albina Muhtari in ihrem Plädoyer auch, dass es in vielen Schulen üblich sei, «Multikulturalität zu feiern». Auf solche Projekte sollen Lehrpersonen besser verzichten.

Studien zeigen laut Ilona Pap auch, dass selbst gut gemeinte Signale von Offenheit und Multikulturalismus nicht immer positiv wirken. «Sie können das Gefühl verstärken, anders zu sein, und so das Selbstwertgefühl von Kindern mit Migrationshintergrund beeinträchtigen.»
«Herkunft nicht tabuisieren»
Dass manche Menschen die Frage nach der Herkunft nicht als verletzend empfinden, ist für die Migrationssoziologin nachvollziehbar. «Insbesondere, wenn sie in einer privilegierten oder wenig stigmatisierten Position sind.» Als Beispiel nennt sie weisse Zuwanderer aus Deutschland.
«Das Ziel darf nicht sein, Herkunft oder Unterschiede zu tabuisieren und unsichtbar zu machen», so Paps Fazit. So zu tun, als gäbe es keine Unterschiede, wirke auf den ersten Blick gerecht.
«Der ‹Color-Blind›-Ansatz blendet aber reale Ungleichheiten und Diskriminierung aus.» Betroffene blieben mit ihren Erfahrungen oft allein.
Sie schlägt deshalb ein offenes Format vor. «In diesem können alle Kinder, wenn sie möchten, etwas über ihre Familie, Sprache, Geschichte, Traditionen oder besondere Erfahrungen erzählen.»
So entstehe Raum für Selbstbestimmung und echte Wertschätzung von Vielfalt. Kinder würden auf diese Weise nicht fremdbestimmt kategorisiert.