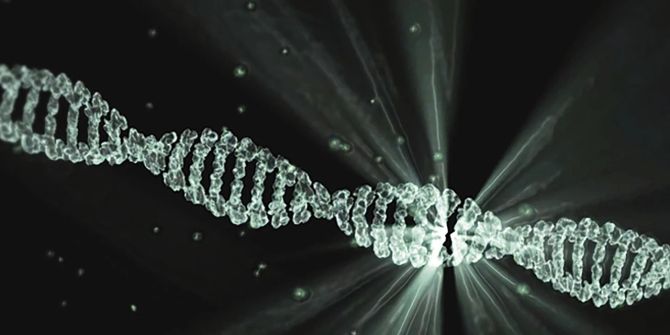Schutzgebiete allein reichen im Kampf gegen Artenschwund nicht aus
Laut einer deutschen Studie hat die Ausweitung von Schutzgebieten eine wichtige Bedeutung, um dem Rückgang der biologischen Vielfalt zu begegnen.

Das Wichtigste in Kürze
- Laut einer Studie hat die Ausweitung von Schutzgebieten eine wichtige Bedeutung.
- Dies, um dem Rückgang der biologischen Vielfalt zu begegnen.
- Das ist ein Ergebnis einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
Um dem Rückgang der biologischen Vielfalt zu begegnen, hat die Ausweitung von Schutzgebieten eine wichtige Bedeutung. Diese muss aber durch Massnahmen ausserhalb dieser Gebiete ergänzt werden. Das ist ein zentrales Ergebnis einer Studie unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Sie wurde in der Fachzeitschrift «Nature Communications» veröffentlicht.
Am Dienstag erklärte dazu PIK-Leitautor Patrick von Jeetze: «Die Tatsache, dass sich die internationale Gemeinschaft darauf geeinigt hat, 30 Prozent der Landfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen, ist ein wichtiger Schritt nach vorn.» Und fügte hinzu: «Aber wir sollten auch die übrigen 70 Prozent nicht vergessen.»
Er verwies auf die grosse Bedeutung naturnaher Flächen auch in intensiv genutzten Landschaften und in der Nähe menschlicher Siedlungen.

Jeetze erklärte weiter: «Ein gut funktionierendes Netzwerk aus vielfältigen Lebensräumen trägt dazu bei, Schutzgebiete effektiver miteinander zu verbinden. Es ermöglicht auch, dass sich Arten an veränderte Umweltbedingungen anpassen können.» Dies sei «in Zeiten des Klimawandels besonders wichtig».
Studie: Räumliche Verteilung von Flächen wichtig
Ko-Autorin Isabelle Weindl verwies auf einen breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, «dass zehn bis 20 Prozent der Fläche in intensiv genutzten Landschaften dauerhaft als Lebensräume erhalten werden sollten, um eine ökologische Reserve zu schaffen und um Schutzgebiete miteinander zu verbinden». Dies könnten extensiv bewirtschaftete Grünflächen sein, aber auch zum Beispiel Heckenlandschaften.
Die Studie zeige, «dass der Erhalt dieser Lebensräume in Agrarlandschaften auf globaler Ebene prinzipiell möglich wäre, selbst in Szenarien mit starker Konkurrenz durch Ackerflächen oder der Ausweitung von Schutzgebieten», erklärte Weindl weiter. Wichtig ist dabei der Studie zufolge auch die räumliche Verteilung von Flächen unterschiedlicher Nutzung. Synergieeffekte liessen sich hier zugleich zwischen Arten- und Klimaschutz erzielen.
Ko-Autor Alexander Popperklärte: «Landschaften, die unsere Biodiversität schützen, sind kein 'nice-to-have', sondern entscheidend für eine nachhaltige, kosteneffiziente landwirtschaftliche Produktion auf Basis natürlicher Ressourcen.» Dringend notwendig sei eine Politik, «die die verschiedenen Umweltziele mit besseren Rahmenbedingungen für Landwirte verbindet».
Dies sei wichtig für das Erreichen der globalen Ziele für den Klima- und Biodiversitätsschutz, aber auch, «um Landwirte und andere Akteure mitzunehmen».