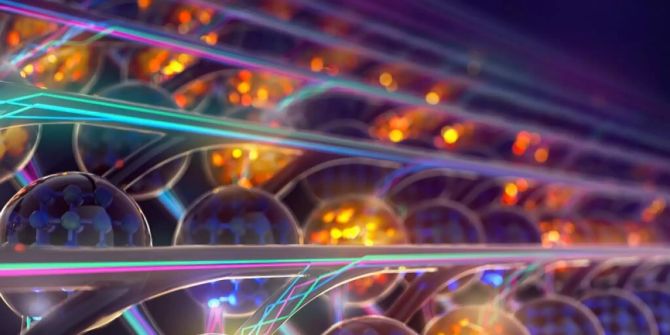Lausanner Forscher optimieren Netzhautimplantat
Bisherige Implantate haben ein Gesichtsfeld von 20 Grad ermöglicht. In Lausanne erreichte man an der ETH jetzt 46 Grad.

Das Wichtigste in Kürze
- In Lausanne haben Wissenschaftler der ETH ein Netzhautimplantat entwicklet.
- Erblindete sollen so ein Teil ihres Gesichtsfeldes wieder kriegen.
Wissenschaftler an der ETH Lausanne (EPFL) haben ein neuartiges Netzhautimplantat entwickelt. Es dient Menschen, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen in ihrer Netzhaut erblindet sind. Das Implantat stellt ihr Gesichtsfeld teilweise wieder her. Zwei bis vier Millionen der 32 Millionen Blinden weltweit verdanken ihren Zustand dem Verlust von lichtempfindlichen Zellen in ihrer Netzhaut.
Die vielversprechendste Behandlung für diese Art von Blindheit ist ein Netzhautimplantat, das Elektroden enthält, die die Netzhautzellen elektrisch stimulieren. Bisherige Implantate ermöglichen aber nur ein Gesichtsfeld von 20 Grad. EPFL-Forscher erreichen aber mit ihrer Variante ein Gesichtsfeld von 46 Grad.
Die Träger von herkömmlichen Implantaten «gelten immer noch als gesetzlich blind», sagt Diego Ghezzi. Ghezzi hat den Medtronic-Lehrstuhl für Neuroengineering (LNE) an der School of Engineering der EPFL inne. «Um ein ‹normales› Leben führen zu können, muss der Implantat-Träger ein Gesichtsfeld von mindestens 40 Grad wiedererlangen.»
Gesichtsfeld von 46 Grad und bessere Auflösung
Die LNE-Forscher haben ein bahnbrechendes, kabelloses Implantat entwickelt, das aus einem hochflexiblen und biegsamen Material besteht und photovoltaische Pixel enthält. Es soll dem Träger ein Gesichtsfeld von 46 Grad und eine deutlich bessere Auflösung bieten. Diese Ergebnisse wurden kürzlich in «Nature Communications» veröffentlicht.

Die derzeit verfügbaren Netzhautimplantate bestehen aus einem Gitter von Elektroden, die direkt auf der Netzhaut platziert werden. Die Implantate sind mit einer Brille und einer Kamera sowie mit einem tragbaren Mikrocomputer verkabelt. Die Kamera nimmt Bilder auf, die in das Sichtfeld des Implantats gelangen. Sie sendet sie dann an den Computer, der sie in elektrische Signale umwandelt, die er an die Elektroden weiterleitet.
Die Elektroden stimulieren die retinalen Ganglienzellen basierend auf den im Sichtfeld erkannten Lichtmustern. Der Implantant muss dann lernen, die eingehenden visuellen Eindrücke zu interpretieren, um die Bilder zu «sehen». Je zahlreicher und detaillierter die Muster sind, desto einfacher ist es für den Träger, sie zu erkennen.
Keine Energiequelle benötigt
Das Implantat der EPFL kommt ohne Drähte aus. Es hat auch eine grössere Oberfläche, die das Gesichtsfeld verbreitern und die Bildqualität verbessern soll. Die grössere Fläche bedeutet auch, dass mehr Netzhautzellen durch die Photovoltaik-Pixel stimuliert werden.
Die LNE-Forscher haben auch ein flexibles, faltbares Polymer verwendet. Damit können die Schnitte bei der Implantation der Linse möglichst klein gehalten werden.
Sie setzen ausserdem auf solarbetriebenen Pixel, die selbst einen elektrischen Strom erzeugen und keine externe Energiequelle benötigen. Da sie weniger Platz einnehmen als Elektroden, können sie dichter angeordnet werden, was die Sehschärfe erheblich verbessert.