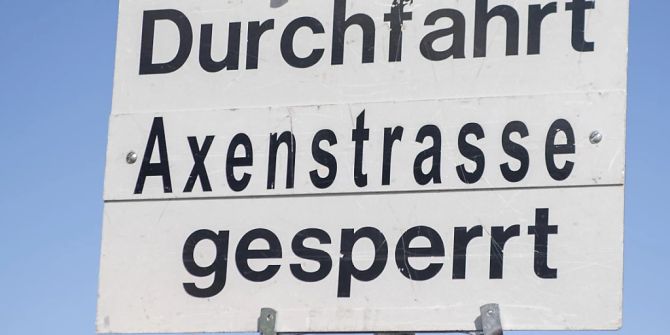«Die letzten Tage der Menschheit»: Erfolg für Premiere
Die Premiere des Antikriegsdramas «Die letzten Tage der Menschheit» bei den Salzburger Festspielen war ein Erfolg.

«Mehr Stahl ins Blut». Der Geistliche schwärmt vom Krieg und schenkt dem Patrioten einen kiloschweren Rosenkranz, aus Waffenresten geschmiedet. Es ist eine der 220 Szenen aus dem Antikriegsdrama «Die letzten Tage der Menschheit» des österreichischen Satirikers Karl Kraus (1874-1936). In einer auf sieben Schauspieler und Dutzende Szenen reduzierten Fassung feierte das eigentlich 800-seitige Monumentalwerk über den Ersten Weltkrieg am Freitagabend äusserst erfolgreich Premiere bei den Salzburger Festspielen.
Das Publikum auf der Pernerinsel war begeistert und spendete langen Applaus. Dem exzellenten Ensemble des Wiener Burgtheaters rund um Michael Maertens und Dörte Lyssewski gelang es mit den Texten von Kraus, die verstörenden und aufrüttelnden Analogien zu aktuellen Kriegen und zur verbreiteten Kriegsrhetorik aufzuzeigen.
Kraus demaskierte die damaligen Eliten mit ihren verblendeten, inhumanen Ansichten mit einer Collage aus Zeitungsartikeln, Heeresberichten und anderen Dokumenten. Er zeigte auch, dass die damaligen Medien und die Dumpfheit der Bevölkerung zum Krieg – und damit zur Urkatastrophe Europas mit zehn Millionen Toten – beitrugen.
Verlust von Werten, Verfall der Sprache
Dem tschechischen Regisseur Dušan David Pařízek gelang es, aus dem Stück eine in sich homogene und entlarvende Szenenfolge zu machen. Ganz im Sinne von Kraus ging es Pařízek darum, die Sprache als mögliches Mittel von Demagogie und Verdummung zu behandeln. Verlust von Werten gehe mit dem Verfall der Sprache einher, schreibt die Dramaturgin Lena Wontorra. «Ein Verfall, der sich im 21. Jahrhundert potenziert und dessen radikalste Auswüchse sich in den Echokammern digitaler Propaganda beobachten lassen.»
Der Regisseur hat auch die Bühne gestaltet und dabei ganz auf einen riesigen, an zwei Seiten offenen Würfel gesetzt, der als Projektionsfläche für die vielen Videos dient, aber auch als zusätzlicher Bühnenraum. Texte werden – gekonnt – gesungen, die Schauspieler sprechen Schweizerdeutsch, Pfälzisch, mit norddeutschem Zungenschlag oder auch Oberösterreichisch. In der Kriegsallianz zwischen der Habsburger-Monarchie und Deutschland gab es viele Töne.
Zur Aufbesserung der Kriegskasse ein «Russentod-Osterei»
Anlass zur Betroffenheit bietet das Drama in Fülle: «A bissel a Aufmischung», erhofft sich die Figur des Patrioten nach den lähmend-langweiligen Friedensjahren vom Krieg. Eine Mutter bedauert, dass sie einen nicht wehrpflichtigen Sohn und eine Tochter hat, und so leider fürs Vaterland keine Kinder an die Front schicken kann. Zur Aufbesserung der heimischen Kriegskasse wird ein «Russentod-Osterei» feilgeboten. Ein Offizier ergötzt sich an der Vergewaltigung einer jungen Frau und daran, dass er sie anschliessend seinen Soldaten überlassen habe.
Eine halbe Stunde vor Schluss fällt plötzlich der Vorhang. Es ist nicht das Ende, sondern eine Zäsur. In der restlichen Zeit minimiert der Regisseur den bisherigen Schwung der Aufführung und konzentriert sich ganz auf den Text. Das macht viele im Publikum umso nachdenklicher. Das Stück zeige weniger, wie es im Ersten Weltkrieg gewesen sei, «sondern wie es wird, wenn wir dieselben Fehler wiederholen», so Wontorra.