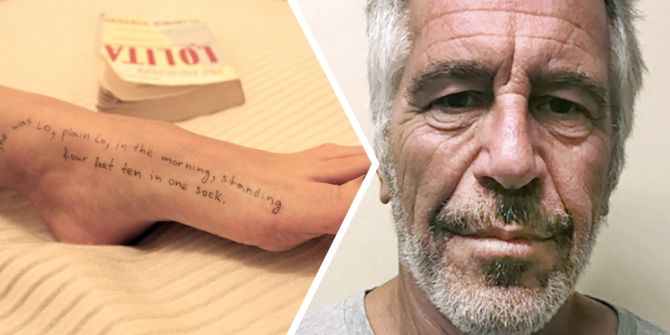Offene Punkte bei Einheitsfinanzierung der Gesundheitsleistungen
Der sogenannte Monismus soll bei Gesundheitsleistungen eingeführt werden. Die beiden Parlamentskammern sind sich aber noch sehr uneinig, in vielen Punkten.

Dass ambulante und stationäre Leistungen für die Gesundheitsversorgung künftig einheitlich finanziert werden sollen, hat das Parlament bereits beschlossen. Bei der Langzeitpflege gibt es aber noch etliche offene Punkte, auch nach der jüngsten Ständeratsdebatte.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) hatte beantragt, an bisherigen Beschlüssen festzuhalten. Dies mit einer deutlichen Mehrheit. Der Ständerat folgte ihr am Mittwoch. Die Vorlage geht deshalb zurück an den Nationalrat und soll in der laufenden Session bereinigt werden.
National- und Ständerat in vielen Aspekten uneins
Grundsätzlich sind sich die Räte einig, dass die Langzeitpflege in den sogenannten Monismus integriert werden soll. Doch viele Details sind umstritten: Der Ständerat will für die Integration der Pflege eine fixe Frist von sieben Jahren ab 1. Januar nach Zustandekommen der Revision setzen. Der Nationalrat hingegen will zusätzliche Bedingungen erfüllt sehen, die der Ständerat ablehnt.

Nach Meinung des Nationalrates soll die Integration erst erfolgen, wenn die Tarife im Pflegesektor auf einer einheitlichen und transparenten Kostenbasis festgelegt sind. Auch will er, dass vor der Integration die Pflegeinitiative vollständig umgesetzt ist.
Peter Hegglin (Mitte/ZG) wollte diesenn Vorschlag des Nationalrats übernehmen: Als zusätzliche Voraussetzung für den Systemwechsel sollten für Pflegeleistungen Tarife vorliegen, die auf einer einheitlichen, transparenten Kosten- und Datenbasis beruhen. Der Rat lehnte Hegglins Antrag aber mit 31 zu 12 Stimmen ab.
Die zuständige Kommission hatte befunden, dass die Festlegung einer präzisen Frist für den Einbezug der Pflege grössere Rechtssicherheit gewährleiste. Das Kriterium der vollständigen Umsetzung der Pflegeinitiative könne nicht genau definiert werden.
Ebenfalls will der Ständerat den Patientenbeitrag an die Pflegeleistungen beibehalten – um erhebliche Zusatzkosten zulasten der Kantone zu vermeiden. Pflegebedürftige bezahlen zurzeit 23 Franken pro Tag für diese Leistungen. Nützen würde die Streichung des Beitrages vor allem Versicherten in guten finanziellen Verhältnissen, sagte Kommissionspräsident Erich Ettlin (Mitte/OW). Der Nationalrat ist aber anderer Meinung.

Um einen Prämienanstieg zu verhindern, will der Ständerat den Anteil der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) an der Finanzierung von Vertragsspitälern – Spitäler, die nicht auf kantonalen Spitallisten stehen – bei den heutigen 45 Prozent behalten. Der Nationalrat will einen höheren Beitrag zulassen.
Die Vorlage bringt eine grundlegende Reform bei der Finanzierung von Gesundheitsleistungen, nämlich deren Finanzierung aus einer Hand. Heute werden ambulante Behandlungen allein von den Krankenkassen bezahlt, aus Prämiengeldern.
Stationäre Leistungen dagegen werden zu mindestens 55 Prozent von den Kantonen finanziert. Den Rest bezahlen die Kassen. Und für die Langzeitpflege gelten spezifische Regeln.
Ziel der komplexen Monismus-Vorlage ist es, die Finanzierung der Gesundheitsleistungen einheitlich zu regeln. Krankenkassen und Kantone sollen die von der Grundversicherung gedeckten ambulanten und stationären Behandlungen gemeinsam bezahlen. Unter dem Strich soll die «Einheitliche Finanzierung ambulant und stationär» (Efas) kostenneutral sein.