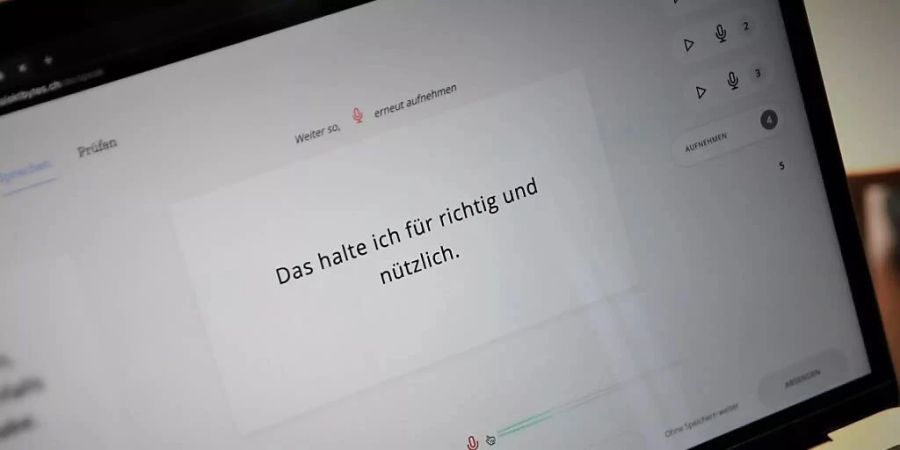Schweizerdeutsch im Büro lässt Migranten verzweifeln
Wer kein Schweizerdeutsch versteht, wird in Meetings oft abgehängt. Integrationsexperten warnen: Ohne klare Sprachregeln droht schleichende Diskriminierung.

Das Wichtigste in Kürze
- In der Deutschschweiz dominiert Dialekt auch im Berufsalltag – zum Nachteil Zugezogener.
- Viele Migranten fühlen sich ausgeschlossen, da Hochdeutsch allein oft nicht reicht.
- Fachleute kritisieren, dass es kaum Vorgaben für Hochdeutsch am Arbeitsplatz gibt.
Den Deutschschweizern sind ihre Dialekte heilig: Sie sind eng mit der Identität verknüpft und dominieren nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Berufsalltag.
Für Neuzuziehende ist das ein Problem. Hochdeutsch pauken reicht nicht: Wer kein Schweizerdeutsch versteht, gerät schnell ins Abseits. Wichtige Infos gehen verloren, das Gefühl von Ausschluss wächst.

Genau so erging es einer Migrantin aus dem Gesundheitswesen, die ihren Frust auf Reddit teilt. Seit einiger Zeit lerne sie Hochdeutsch und sei dabei, es im Alltag anzuwenden.
Bloss: «An meinem Arbeitsplatz wechseln die Leute in grossen Gruppenmeetings ständig auf Schweizerdeutsch, obwohl viele es nicht vollständig verstehen.»
Sie gesteht: «Ich würde wirklich gerne alles verstehen, was gesagt wird, aber leider ist das derzeit nicht der Fall. Ich fühle mich demotiviert und stecke in einem Teufelskreis fest.»
«Das kann sehr schnell in Richtung Diskriminierung gehen»
Integrationsfachleute hören solche Geschichten ständig. Dass Schweizerinnen und Schweizer im Berufsalltag Mundart sprechen, obschon Dialekt-unkundige Ausländerinnen und Ausländer anwesend sind, sei ein verbreitetes Phänomen.
Oft hat das mit Gewohnheit, Emotionen und fehlender Übung im Hochdeutsch zu tun. Die Schriftsprache sei für viele Schweizerinnen und Schweizer «die erste Fremdsprache, die sie lernen mussten», erklärt Tom Morgenegg. Er ist Leiter der isa-Fachstelle Migration in Bern.
Schnell werde deshalb in die Mundart gewechselt und gesprochen, wie einem «der Schnabel gewachsen ist», so Morgenegg.
Besonders oft passiere der Switch in lockeren Momenten wie Kaffeepausen, berichtet Michele Puleo von der Anlaufstelle Integration Aargau: «Teams sprechen Schweizerdeutsch und schliessen damit auch Mitglieder aus.»
Manche würden sogar «aus Überzeugung» an der Mundart festhalten, betont Hamit Zeqiri vom Kompetenzzentrum Fabia in Luzern. Ganz nach dem Motto: Das ist meine Sprache, die anderen sollen sich anpassen.
Das könne «sehr schnell in Richtung Diskriminierung» gehen, mahnt Morgenegg. Es brauche deshalb eine Unternehmenskultur, in der Standardsprache selbstverständlich ist.
Doch eine solche fehle oft: «Es gibt erstaunlich wenige Vorgaben der Leitungen, in denen festgeschrieben ist, dass man in Standardsprache spricht.»
Betroffene sollen das Gespräch suchen
Für Betroffene können die Folgen gravierend sein, warnt Morgenegg: Wer trotz grosser Anstrengung immer wieder das Gefühl habe, nicht dazuzugehören, «schmeisst irgendwann die Flinte ins Korn».
Auch Puleo und Zeqiri beobachten, dass der Dialektgebrauch Migrantinnen und Migranten demotivieren und ausschliessen kann.

Was also tun? Die Experten sind sich einig: Schweigen ist keine Lösung. «Es braucht zwar viel Überwindung, aber ansprechen ist eine gute Strategie», sagt Puleo.
Morgenegg rät Migrantinnen und Migranten zusätzlich, sich verständnisvolle Schweizerinnen und Schweizer im Team zu suchen: «Diese Verbündeten können etwas bewirken und ihnen den Stress abnehmen, indem sie einfordern, dass Hochdeutsch gesprochen wird.»
Der andere Fall: Expats sehnen sich nach Dialekt
Ganz anders präsentiert sich die Lage in internationalen Städten und Konzernen. Viele Expats in Zürich kennen das Problem nicht, wegen des Dialekts abgehängt zu werden. Eher im Gegenteil.
«Meine Klienten berichten, dass sie lieber Dialekt hören möchten, um es zu lernen. Die Schweizer ‹schalten› aber immer gleich auf Hochdeutsch», sagt Expat-Coach Lucja Bernhart.
In grossen Firmen sei ohnehin Englisch Standard, Schweizerdeutsch höchstens in der Kaffeepause ein Thema.
Auch Unternehmen wie Roche und UBS betonen, dass Inklusion bei der Sprachwahl selbstverständlich sei.
«Meetings werden in der Schweiz in der Regel auf Englisch oder Deutsch durchgeführt. Ausschlaggebend für die Sprachwahl ist, dass alle Teilnehmenden der jeweiligen Sprache mächtig sind», schreibt Roche auf Anfrage.
Bei der UBS tönt es ähnlich: Es gebe zwar keine fixen Vorgaben. Aufgrund der grossen Vielfalt sei Englisch aber häufig die gemeinsame Sprache. Ziel sei stets, «dass alle Teilnehmenden ihre Expertise einbringen können und sich gehört fühlen».
Damit zeigt sich: Während in internationalen Konzernen meist Englisch dominiert, bleibt der Dialekt insbesondere in kleineren und weniger global geprägten Umfeldern eine Hürde.
Wer neu ist, braucht Mut, Geduld, Hartnäckigkeit – und manchmal auch eine Prise Humor. Bernharts Rat: «Ein paar Worte Schweizerdeutsch lernen und den Satz ‹Exgüse, ich verstah das nöd› bringen. Mit Fehlern, ungeschickt – aber selbstbewusst.»