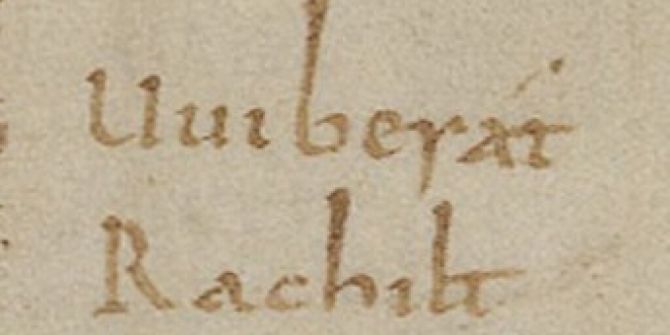Studie der Uni St. Gallen zu Gefährdern und Bedrohungs-Management
Wie eine neue Untersuchung zeigt, sind sogenannte Gefährder in vielen Fällen arbeitslos und fast ebenso häufig psychisch krank.

Das Wichtigste in Kürze
- Sogennante Gefährder sind in vielen Fällen arbeitslos und häufig psychisch krank.
- Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Untersuchung der Uni St. Gallen.
Sogenannte Gefährder, die als potenzielle Gewalttäter im Fokus der Behörden stehen, sind in vielen Fällen arbeitslos und fast ebenso häufig psychisch krank. Dies zeigt eine Untersuchung der Universität St. Gallen (HSG) zum Bedrohungsmanagement in den Kantonen Zürich, Bern und St. Gallen.
Die Professorinnen Nora Markwalder und Monika Simmler vom HSG-Kompetenzzentrum für Strafrecht und Kriminologie nahmen rund 300 Fälle unter die Lupe, wie die Universität am Freitag mitteilte. Untersucht wurde, welche Personengruppen die behördlichen Fachstellen als Gefährder registriert haben.
In rund 94 Prozent der Fälle handelt es sich um Männer. Die Altersspanne ist relativ breit. Etwa die Hälfte der Betroffenen sind 26 bis 45 Jahre alt. 54 Prozent dieser potenziell gefährlichen Personengruppe sind Schweizer Staatsangehörige, 46 Prozent haben andere Nationalitäten.
Zu gut einem Drittel (38 Prozent) sind die Betroffenen arbeitslos, fast ebenso oft (33 Prozent) sind sie psychisch erkrankt. In knapp der Hälfte der untersuchten Fälle geht es um häusliche oder sexuelle Gewalt und Vorfälle in intimen Beziehungen, wie die Universität St. Gallen schreibt.
Rolle von KI untersucht
Rund ein Viertel der Gefährder geriet wegen Bedrohung öffentlicher Amtsträgerinnen und Amtsträger in den Fokus der Behörden. Selten sind mit 5,2 Prozent die Fälle von Extremismus und Radikalisierung. «Da haben wir nur vereinzelt Fälle gefunden», erklärt Professorin Nora Markwalder im Video zur Studie.
Untersucht wurde auch, welche Rolle Algorithmen und künstliche Intelligenz (KI) bei der Risikobeurteilung spielen. Zur Anwendung kommt laut Markwalder vor allem ein Checklisten-Programm, mit dem sich Risikoprofile erstellen lassen. Dies habe aber mit KI relativ wenig zu tun.
Mit dem Bedrohungsmanagement will die Polizei Delikte präventiv erkennen und dadurch verhindern. Zum Teil sammeln die Behörden Informationen über Gefährderinnen und Gefährder, zum Teil sprechen sie die Personen auch direkt an. Dies geschieht gemäss der Studie häufig in einer Grauzone zwischen Polizei- und Strafprozessrecht.
Dadurch gebe es rechtliche Unklarheiten, etwa über die Rechte und Pflichten der Gefährder, sagt Markwalder im Video. Die Forschenden plädierten deshalb für die Schaffung eines klaren rechtlichen Rahmens für das Bedrohungsmanagement, schreibt die Universität St. Gallen.