Der Bosnienkrieg kehrt ins breite Bewusstsein zurück
Nach grausamen Enthüllungen zu sogenannten «Menschensafaris» erfährt der Bosnienkrieg neue Aufmerksamkeit. Doch wie kam es zu der europäischen Katastrophe?

Der Bosnienkrieg brach kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien-Herzegowinas im April 1992 aus. Bis 1995 kam es zu Massakern und Genozid, bis heute sind die Wunden nicht verheilt.
Die politischen Spannungen verschärften sich, als bosnisch-serbische Regionen ihre Autonomie erklärten und sich von Sarajevo lossagten. Diese Entwicklung führte zu eskalierenden Konflikten zwischen Ethnien und politischen Gruppen.
Nationalismus, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten und ethnisch getriebene Machtinteressen prägten die Auseinandersetzungen. Der Zerfall Jugoslawiens hatte die Rahmenbedingungen für den Krieg gesetzt.
Spielball internationaler Kräfte
Schon 1991 hatten die Anerkennungen Sloweniens und Kroatiens zu Unsicherheiten in Bosnien geführt. Die Befürchtung dominanter Nationalismen verfestigte die Fronten zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten.
Westliche Regierungen, darunter Deutschland, befürworteten früh die Unabhängigkeit Bosniens trotz gegenteiliger Signale der serbischen Bevölkerung. Frühere Warnungen vor einem möglichen Bürgerkrieg seien laut der «Jungen Welt» ungehört geblieben.
Militärische Unterstützung der USA für muslimische und kroatische Kräfte veränderte in der Folge das Kräfteverhältnis. Kritiker betrachten die Eingriffe als Teil eines internationalen Machtspiels, das den Krieg weiter befeuerte.
Der Bosnienkrieg als offene Wunde
Laut der «Bundeszentrale für politische Bildung» wirkten ethnische Spannungen, alte historische Konflikte und territoriale Ansprüche wirkten kumulativ zusammen. Die fragile politische Ordnung zerbrach, was zum voll entfachten Bürgerkrieg führte.
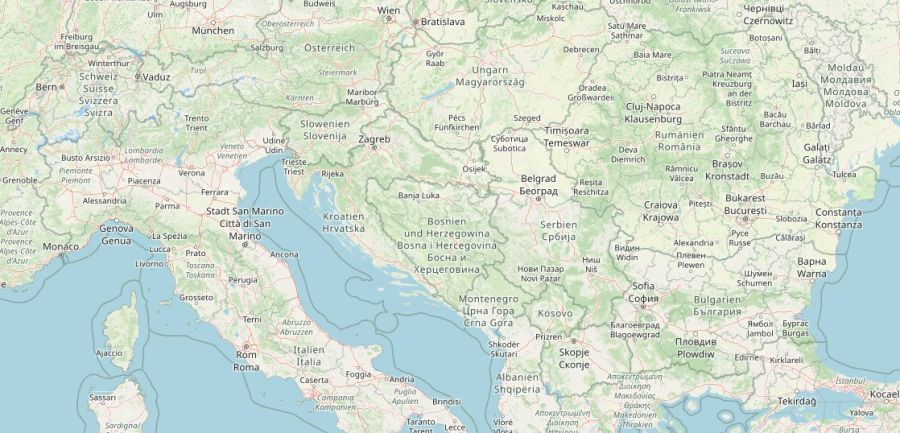
Der Krieg hinterliess massive Zerstörungen, zehntausende Opfer und eine tief gespaltene Gesellschaft. Bis heute ist die Aufarbeitung des Konflikts schwierig.












