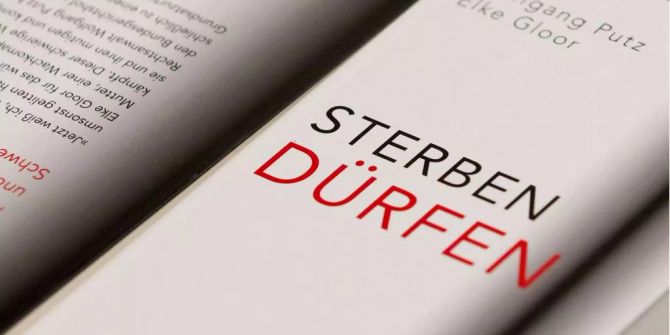Asylsuchende sollen mit Demenz Patienten spazieren gehen
Statt einem Altersheim, entsteht in Bern ein Dorf für demente Menschen. Lohnt sich das? Und warum müssen Demente sich aus dem Weg gehen können?

Das Wichtigste in Kürze
- Für demente Menschen ist das Altersheim unpassend. Sie brauchen Unterhaltung und Bewegung.
- Darum soll in Bern ein Demenz-Dorf gebaut werden.
- Der ehemalige Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein erklärt, wie das funktionieren kann.
Im Berner Dettenbühl soll ein Dorf für demente Menschen entstehen. Dazu hat die Schweizer Armee gestern eine alte Mühle gesprengt. Weichen muss die Mühle 23 Wohnungen, einem Supermarkt und einem Coiffeurladen für demente Menschen. Vorbild ist das niederländische Demenzdorf «De Hogeweyk».
Warum denn gleich ein Dorf? Alters- und Pflegeheime gibt es doch schon? Das wollte Nau vom ehemaligen Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein wissen.
Das Hotel-System funktioniert nicht
«Das klassische Altersheim funktioniert ja eigentlich wie ein Hotel: Die Leute sind meistens auf ihrem Zimmer, können Fernsehen oder kurz Spazieren gehen. Sie haben ihre Ruhe und man trifft sich zum Essen im Speisesaal und oder zu einem wöchentlichen Anlass wie einem Konzert oder Handarbeit», beginnt Wettstein, «aber für Demente ist das ungeeignet».

Demente Menschen können sich ihren Tag je länger je weniger selber einteilen und sich selber beschäftigen. Alleine in ihrem Zimmer zu warten, ist für sie schlimm. Sie brauchen Unterhaltung und haben oft einen grossen Bewegungsdrang. «Mindestens jeder zweite Schweizer spaziert gerne und demente Menschen sind da nicht anders – und zudem körperlich oft noch sehr fit», erklärt Wettstein, der mehrere Studien auf dem Gebiet der Demenz durchgeführt und betroffene Menschen begleitet hat.
Was aber wäre die perfekte Lösung für einen Demenz-Patienten? Wettstein schüttelt den Kopf. «Gerade bei Demenz-Patienten gibt es keine Patentlösung. Denn die ersten paar Jahre der Erkrankung und die letzten sind grundverschieden.»
Gut geschultes Pflegepersonal ist das A und O
Während ein Demenz-Dorf mit Wohngemeinschaften in den ersten Jahren für viele gut passen würde, «zumindest, solange sie auch noch sprechen und zum Beispiel beim Kochen helfen können», ändere sich das im letzten Stadium der Krankheit. «Dann braucht es eine Art Oase, wo die bettlägerigen Patienten etwas unterhalten und vor allem gepflegt werden», so Wettstein.

Gute pflegerische Betreuung – egal ob im Altersheim oder im Demenz-Dorf – sie ist das A und O: «Wenn das Pflegepersonal nicht gut genug geschult ist, und nicht weiss, wie mit den Patienten umzugehen, dann ist das verheerend», sagt Wettstein. Apathie und Aggression, zwei typische Zustände für Demente, führt er in erster Linie auf unpassende Pflege zurück. «Wenn ein Mensch mit Demenz eben lieber spazieren gehen will, als sich waschen zu lassen, gibt es Ärger. Das endet nicht selten mit Schreien und Schlagen», erklärt Wettstein. Die Apathie hingegen komme oft davon, dass Menschen mit Demenz sehr bewegungsfreudig seien: «Weil das betreuungsintensiv ist, werden die Menschen sediert, damit sie ruhig sind. Aber diese Medikamente betäuben auch das Belohnungszentrum im Gehirn. Die Menschen empfinden auch keine Freude mehr», sagt Wettstein.
Sich aus dem Weg gehen können
Seine Lösung: «Das Dorf ist eine gute Idee, aber es sollte durch einen besonderen Dienst ergänzt werden für all jene Menschen, die sich bewegen und spazieren gehen möchten.» Diesen Menschen reicht auch das Dorf nicht, «sie wollen richtig spazieren gehen und auch das Demenz-Dorf endet irgendwann an einem Zaun.» Wettsteins Vorschlag: «Man müsste Spazier-Begleitungen für diese Menschen organisieren. Zum Beispiel Asylsuchende. Denn es geht diesen Menschen nicht um ein Gespräch, sie wollen sich einfach bewegen. Wenn jemand mit ihnen geht und nett mit ihnen spricht – egal in welcher Sprache – tut ihnen das wahnsinnig gut.»
Was die Wohngemeinschaften angeht, empfiehlt Wettstein, möglichst mehr als sieben Patienten in eine WG zu quartieren. «Eine meiner Studien hat gezeigt, dass Menschen glücklicher sind in grossen Wohngemeinschafen. Dort haben sie Platz und Abwechslung – und sie können den Mitbewohnern, die sie nicht mögen, aus dem Weg gehen. Das tut ihnen genauso gut, wie uns Gesunden.»