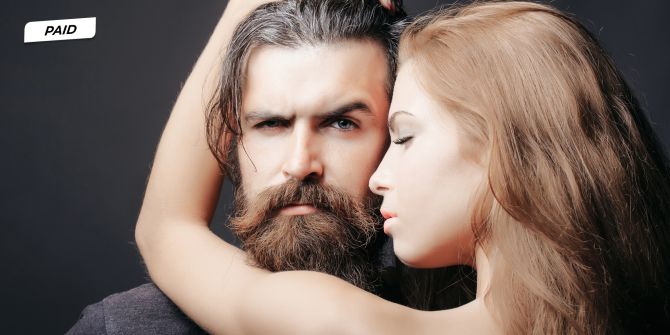Was sind Verdickungsmittel?
Verdickungsmittel stecken in vielen verschiedenen Lebensmitteln und kommen auch in der heimischen Küche zum Einsatz. Trotzdem sehen viele sie kritisch.

Das Wichtigste in Kürze
- Verdickungsmittel kommen in vielen Fertiggerichten zum Einsatz.
- Manche gelten als Lebensmittel, andere müssen als Zusatzstoffe deklariert werden.
- Sie binden Wasser und verdicken so verschiedene Lebensmittel.
Sie kommen in vielen Fertiggerichten vor und werden auch in der heimischen Küche eingesetzt. Dennoch haben Verdickungsmittel, wie andere Zusatzstoffe auch, einen schlechten Ruf.
Dabei gibt es zwischen den einzelnen Stoffen grosse Unterschiede.
Verdickungsmittel bindet Wasser
Verdickungsmittel binden Wasser und geben den Lebensmitteln mehr Struktur. Dadurch werden sie cremiger und erhalten eine festere Konsistenz. Zum Einsatz kommen sie deshalb häufig in Saucen oder in Joghurt.
Speziell bei fettreduzierten Produkten werden Verdickungsmittel gerne eingesetzt. Dort sorgen sie für eine Konsistenz, die dem Originalprodukt ähnlich ist.

Auch in der Küche kommen sie in Form von Gelatine, Pektin und Stärke zum Einsatz. Dort werden sie zum Beispiel im Gelierzucker bei der Herstellung von selbst gemachter Konfitüre verwendet.
Verdickungsmittel haben einen schlechten Ruf
Verdickungsmittel kann man in zwei Kategorien unterteilen: Zusatzstoffe und Lebensmittel. Stärke und Gelatine gelten beispielsweise als Lebensmittel und haben keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit.
Bei den Zusatzstoffen lässt sich diese Frage allerdings nicht pauschal beantworten, da viele von ihnen sehr unterschiedlich sind.
Generell werden kennzeichnungspflichtige Verdickungsmittel durch den Gesetzgeber geprüft. Sie dürfen nur in unbedenklichen Mengen eingesetzt werden.
Trotzdem gibt es vereinzelt Stoffe, die immer wieder in der Kritik stehen. Das gilt zum Beispiel für das Carrageen, welches im Verdacht steht, gesundheitsschädlich zu sein.
Diese Annahme beruht allerdings nur auf Tierversuchen, in denen eine abgebaute Form des Carrageens verwendet wurde. Aktuell gilt deshalb, dass ein Tageshöchstwert von 75 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht gesundheitsschädlich ist.