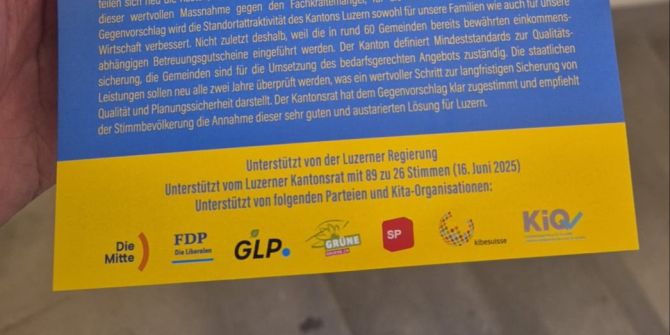So funktioniert das Sharing für Firmen
Eine Lampe aufhängen, aber keine Bohrmaschine zur Hand? Kein Problem mit dem neuen Sharing-Angebot für Unternehmen.

Sharing-Plattformen für Alltagsgegenstände gibt es bereits zuhauf. Für das Teilen von Arbeitsmaschinen, Werkzeugen und Geräten im unternehmerischen Umfeld sind entsprechende Angebote jedoch rar. Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern und der Fachhochschule Nordwestschweiz hat untersucht, wie das Teilen unter Firmen leichter gemacht werden kann.
Sharing soll auch auf industriellen Bereich ausgedehnt werden
Geteilt wird seit Menschengedenken, lang bevor unter dem Begriff «Sharing Economy» neue Geschäftsmodelle entstanden. «Diese Geschäftsmodelle beschränken sich weitestgehend auf den privaten Bereich», sagt Uta Jüttner, Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern. So gibt es für das Teilen von Alltagsgegenständen zwischen Privatpersonen bereits viele Plattformen – auch wenn sie in der Schweiz noch eher selten genutzt werden.
«In der Unternehmenswelt gibt es jedoch kaum institutionalisierte Prozesse, geschweige denn etablierte Plattformen, die das Teilen unter Firmen erleichtern würden», so Jüttner weiter. Dies, obwohl Sharing-Projekte zwischen Unternehmen sehr vielversprechend wären, da Unternehmen oft über wertvolle Ressourcen wie teure Maschinen und Ausrüstung verfügen, die hohe Kosten verursachen, wenn sie ungenutzt herumstehen.
«Viele Firmen hätten einen grossen Anreiz, gewisse Gerätschaften mit ihren Mitbewerbern zu teilen, anstatt alles selbst anzuschaffen», sagt die Expertin. Die Hochschule Luzern hat gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz im Forschungsprojekt «KMU Sharingmarket» untersucht, wie das Teilen für Firmen zielgerichtet und strukturiert unterstützt werden könnte.
Bei der Firma nebenan ausleihen: Möglichkeiten schnell ausgeschöpft
Dass das Teilen für Firmen interessant ist, beweist die Realität. «Unsere Forschung hat gezeigt: Gerade KMUs sind bereits ganz gut darin, untereinander Material und Gegenstände auszuleihen», stellt Sebastian Huber, ebenfalls HSLU-Dozent und Projektmitarbeiter, fest. So werden heute schon häufig Ressourcen zwischen kleineren und mittleren Unternehmen ausgetauscht. «Das läuft allerdings ganz intuitiv und informell.
Wenn der Handwerker einen zusätzlichen Handwagen braucht, fragt er die Firma nebenan», führt der Experte aus. Diese Form des Teilens stosse aber schnell an ihre Grenzen. Im Gegensatz zum Bohrer oder Hochdruckreiniger, den Private gegenseitig zum Teilen anbieten, sind Maschinen und Geräte von Unternehmen oftmals sehr teuer. «Wenn solche Geräte geteilt werden, stellen sich zwangsläufig zusätzliche Fragen, beispielsweise zur Haftung oder zur Versicherung», so Huber.
Nachfrage und Angebot zusammenbringen
Damit Sharing zwischen zwei Unternehmen erfolgen kann, muss das eine Unternehmen eine Ressource mit freien Kapazitäten besitzen, die das andere Unternehmen vorübergehend nutzen möchte. Hier beginnt die Schwierigkeit: Wie finden sich Nachfrage und Angebot? «Den eigenen Bedarf und die Verfügbarkeit von Ressourcen offen zu legen, ist entscheidend und oft schon die erste Hürde im B2B Sharing», erklärt Sebastian Huber.
Die Resultate des Forschungsprojekts zeigen: Beteiligte Unternehmen müssen auch ein gemeinsames organisatorisches Verständnis von «Teilen» entwickeln. Soll das Sharing möglichst anonym und nachfragebasiert oder persönlich und partnerschaftlich erfolgen? Auch über den Grad externer Unterstützung durch eine Plattform oder einen Dienstleister müssen sich die Sharing-willigen Unternehmen verständigen.
Ist die Ressource identifiziert und die Form der Transaktion gefunden, gibt es einige Vereinbarungen zu treffen – zu Transport, Versicherung und Kosten. Um die Fortführung von Sharing als Alternative zur Beschaffung einer Ressource dann auch bewerten zu können, möchten die an einer Sharing-Transaktion beteiligten Unternehmen im Anschluss den Prozess evaluieren. Huber: «Für die Unternehmen muss aus dem Sharing gar nicht zwingend direkt ein Gewinn resultieren, der Aufwand muss sich aber am Schluss dennoch lohnen.»
Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit als Treiber
Im steigenden internationalen Wettbewerbsdruck suchen insbesondere KMUs nach alternativen Nutzungsformen zum klassischen «Make-or-Buy» – also der Wahl, ob ein Gerät oder Werkzeug selbst hergestellt und im eigenen Besitz ist oder von einem Lieferanten eingekauft wird.
Wie bei Privatpersonen ermöglicht Sharing den zeitlich begrenzten Zugriff und die Nutzung einer Ressource, die ein Unternehmen aus Kostengründen nicht selbst besitzen und betreiben kann oder möchte. «Nebst Einsparungen vergrössern sich die unternehmerischen Möglichkeiten, auch Dienstleistungen oder Produkte anzubieten, die ohne Sharing nicht angeboten werden könnten», so Huber.
In der Logistikbranche sowie in grösseren Produktionsfirmen mit hohem Energiebedarf werden die ökologischen Potenziale des Sharings von betrieblichen Ressourcen mit hohem CO2-Fussabdruck bereits seit einiger Zeit ausgewiesen. «Das weckt für diese Unternehmen und Branchen ein besonderes Interesse an Sharinglösungen», sagt Uta Jüttner.
Die durch Sharing enger werdende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, bis hin zum gegenseitigen Ausleihen von Mitarbeitenden, stärke den sozialen Zusammenhalt und erhöhe die unternehmerische Flexibilität in einem zunehmend unsicheren Geschäftsumfeld, unterstreicht die HSLU-Expertin.