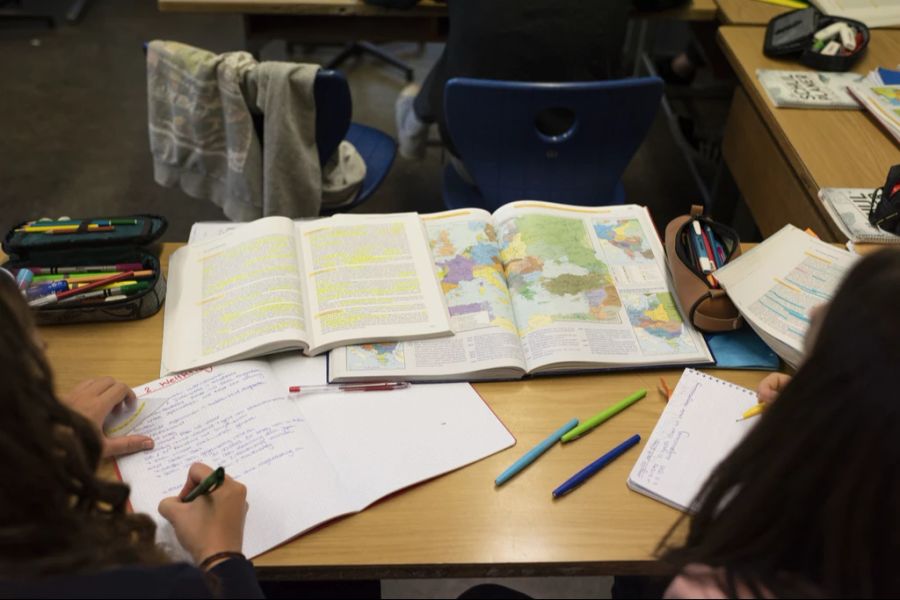Sollen Kids straflos schwänzen dürfen, Frau Rösler?
Immer mehr Schüler fehlen wiederholt und ohne triftigen Grund. Die Lehrerverbände fordern nationale Massnahmen gegen Schulabsentismus.
00:00 / 00:00
Das Wichtigste in Kürze
- Lange Schulabsenzen gefährden Bildung und Psyche – die Fälle nehmen laut Verbänden zu.
- Die Lehrer-Verbände fordern ein Frühwarnsystem und mehr nationale Massnahmen.
- Die Devise lautet: Verständnis statt Sanktionen.
Lange Fehlzeiten in der Schule ohne guten Grund schaden Bildungschancen und psychischer Entwicklung.
Die Lehrerverbände in der Deutsch- und der Westschweiz fordern Massnahmen, um betroffene Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Denn derartige Fälle nehmen zu.
Beim Schulabsentismus gehe es um weit mehr als einfaches Schwänzen. Gemeint seien «Schülerinnen und Schüler, die wiederholt und über mehrere Tage oder Wochen der Schule fernbleiben».
Das schreiben der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) und das Syndicat des Enseignant-es Romand-es (SER) heute in einer Medienmitteilung.
«Macht Sorgen und löst Betroffenheit aus»
Früher sei Schulabsentismus vor allem in der Oberstufe aufgetreten. Heute würden die Zahlen auch im Kindergarten und in der Primarschule zunehmen.
«Das macht Schulen und Lehrpersonen zunehmend Sorgen und löst Betroffenheit aus», sagte LCH-Zentralpräsidentin Dagmar Rösler vor den Medien.
Dabei setzen die Verbände auf eine Haltung des Verstehens – und nicht der Sanktionierung. Sollen Kids also ungestraft schwänzen dürfen?
Es gehe um Kinder und Jugendliche, die der Schule fernbleiben, weil sie Angst haben, erklärt Rösler im Interview mit Nau.ch. Jemanden in solch einem Zustand zu bestrafen sei nicht zielführend. Denn: «Strafen löst Angst aus.»
Dies bedeute keineswegs, dass in der Schule keine Regeln mehr gelten würden. Doch wenn einem Jugendlichen aus psychischen Gründen nicht möglich sei, die Schule zu besuchen, müsse ein nachhaltiger Weg gefunden werden, so Rösler.
Fachleute fordern Frühwarnsystem
An der Medienkonferenz in Bern präsentierten die Verbände ihre Forderungen. Zwar existierten keine Zahlen auf nationaler Ebene, heisst es. Kantone und Städte berichteten aber von einer Zunahme derartiger Fälle. Die Gründe seien in der Regel komplex.
Stephan Kälin, Fachpsychologe für Kinder und Jugendliche, sagt: Der Druck und die Ängste hätten in den letzten Jahren derart zugenommen, dass Eltern ihre Kinder schneller zu Hause behielten.
Zwar wisse ein Kind, dass es in die Schule müsse. Darauf zu beharren, obschon grosse Ängste es ausbremsen, bringe aber nichts, so Kälin weiter. «Das Kind braucht maximale Sicherheit, um sich diesen Ängsten zu stellen.»
Diese Sicherheit müssten Eltern zusammen mit den Schulen schaffen und das Kind anschliessend darin begleiten.
Konkret braucht es gemäss den Verbänden ein ganzes Bündel von Massnahmen. Etwa ein Frühwarnsystem und den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Lehrperson und Kind.
Zudem gelte es, erste Warnsignale wie körperliche Beschwerden zu erkennen. Blieben Kinder oder Jugendliche dem Unterricht regelmässig fern, sei selten die Schule allein der Grund dafür.
Nötig sei ausserdem der Einbezug nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern und weiteren Fachpersonen wie Schulpsychologen oder medizinischem Fachpersonal. Sondern auch von Eltern und der Gesellschaft allgemein.
Dafür brauche es maximale Offenheit, um individuelle und gute Lösungen zu finden, so Kälin.
«Schulen sollten ein unterstützendes Lernumfeld bieten»
Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des LCH, sagt laut Communiqué: «Die Schulen sollten ein unterstützendes Lernumfeld bieten, in dem sich alle Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und vor allem auch gut lernen können.»
Dafür müsse der «Föderalismus überwunden» werden. Es brauche für ein frühzeitiges Eingreifen Massnahmen auf nationaler Ebene.
«Die Schule muss für die Schülerinnen und Schüler ein sicherer Ort bleiben. Ein Ort des Wissens, der Chancengleichheit und der persönlichen Entfaltung», sagte SER-Präsident David Rey.