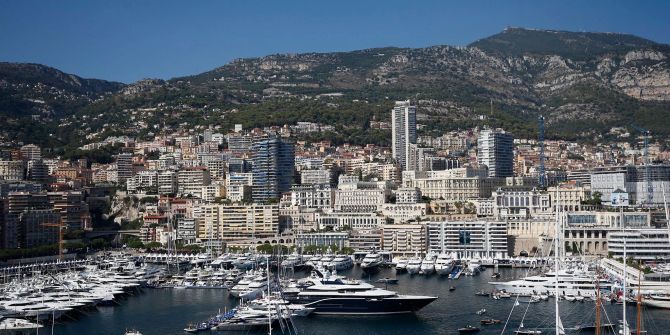Studie: Lebenshaltungskosten verstärken Ungleichheiten
Die Lebenshaltungskosten fördern laut einer Studie die Ungleichheit in der Schweizer Bevölkerung.

Das Wichtigste in Kürze
- Forschende haben die Kostenverteilung der Schweizer Bevölkerung ermittelt.
- Die Lebenshaltungskosten wirken sich dabei deutlich auf die Ungleichheit aus.
- In die Auswertung flossen neben den Lebenserhaltungskosten auch die Steuerdaten ein.
Die Lebenshaltungskosten verstärken laut einer Studie Ungleichheiten in der Schweiz. Zehn Prozent der Spitzenverdiener geben im Schnitt 31 Prozent ihres Einkommens für die Lebenshaltung aus. Demgegenüber sind es der Studie zufolge bei den zehn Prozent der Menschen mit niedrigstem Einkommen im Schnitt 82 Prozent.
Für die Untersuchung in der Zeitschrift «Social Change Switzerland» umfasste die Datenauswertung von drei Millionen Personen in der Schweiz. Beteiligt waren das Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften (Fors), die Berner Fachhochschule und die Universität Bern. Das Fors veröffentlichte eine entsprechende Mitteilung am Donnerstag.
Insbesondere die Alltagsausgaben und Wohnkosten tragen demnach zu einer Verschärfung der Ungleichheit bei. Direkte Steuern und Prämienverbilligungen federn diese Mechanismen teilweise ab.
Die Autorinnen und Autoren schrieben in der Studie: «Die Analyse der Lebenshaltungskosten ist wichtig – insbesondere in einem teuren Land wie der Schweiz.» Bisher sei aber für die Schweiz keine entsprechende Studie vorgelegen.
Um zu quantifizieren, inwiefern diese Unterschiede zu Ungleichheiten beitragen, verwendeten die Forschenden den sogenannten Gini-Index. Dieser ist ein Mass für Ungleichheit einer Verteilung, die vom Statistiker Corrado Gini entwickelt wurde. Der Gini-Koeffizient nimmt den Wert 100 bei absoluter Ungleichverteilung und den Wert 0 bei einer Gleichverteilung an.
Betrachtet man lediglich die Einkommensverteilung in der Schweiz, ergibt sich laut der Studie ein Gini-Koeffizient von 31,3 Punkten. Schliesst man die Lebenshaltungskosten mit ein, erhöht sich dieser Koeffizient um 10,9 Punkte.
Auswertung anhand Lebenserhaltungskosten und Steuerdaten
Für ihre Berechnungen verwendeten die Forschenden Daten des Bundesamts für Statistik zu Lebenshaltungskosten. Zudem nutzten sie die Steuerdaten der Kantone Aargau, Bern, Genf, Luzern, St. Gallen und Wallis.
Die Daten aus 2015 waren für eine andere Studie entsprechend aufbereitet worden. Damit konnten die Forschenden nach eigenen Angaben die finanzielle Situation von 45 Prozent der Schweizer Bevölkerung unter 65 Jahren abbilden.