Brüssel will Lösung mit Schweiz – Rahmen ist aber zwingend
Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, fordert weiterhin einen übergeordneten Rahmen für die bilateralen Verträge mit der Schweiz.

Das Wichtigste in Kürze
- Erstmals seit Abbruch der Verhandlungen ist die Schweiz im EU-Parlament Thema.
- Der Vizepräsident der EU-Kommission fordert weiter einen Rahmen für bilaterale Verträge.
- Er unterstreicht dabei, dass die Schweiz von ihrer Teilnahme am EU-Binnenmarkt profitiere.
Zum ersten Mal seit Verhandlungsabbruch zwischen Schweiz und EU zum institutionellen Rahmenabkommen diskutierten die Abgeordneten im EU-Parlament zum Thema Schweiz.
Die Schweiz und die EU seien mehr als nur Nachbarn. «Sie sind Partner», sagte Sefcovic und verwies auf die starke ökonomische Verflechtung.
Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Schweiz sehr von ihrer Teilnahme am EU-Binnenmarkt profitiert. Ausserdem kämen die Abkommen zwischen der Schweiz und der EU in die Jahre, sagte der EU-Vize-Kommissar weiter.
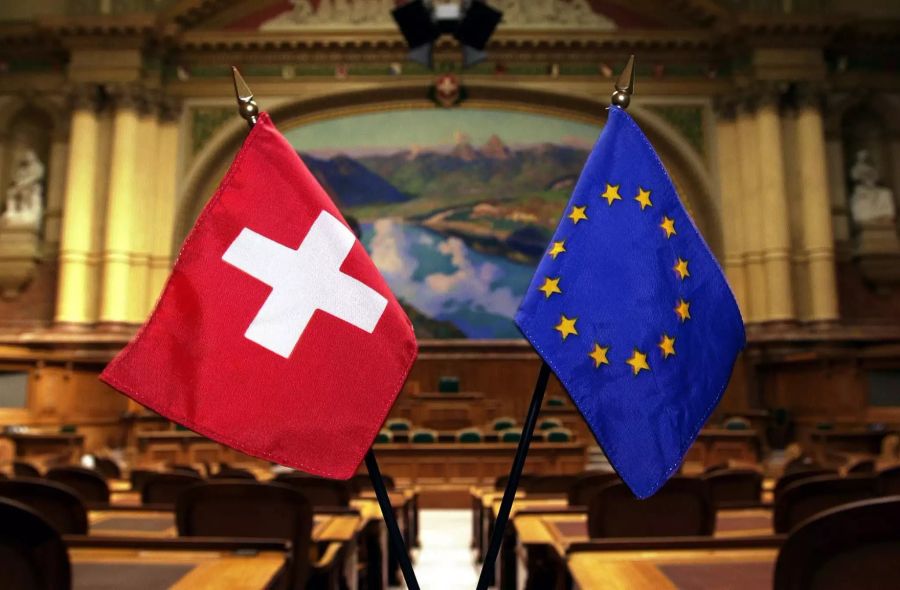
So sei das Freihandelsabkommen rund 50 Jahre und die bilateralen Abkommen rund 20 Jahre alt und bräuchten eine Modernisierung. Denn Probleme wie die staatlichen Beihilfen und die Streitbeilegung sowie ein regelmässiger finanzieller Beitrag seitens der Schweiz seien nicht geregelt. Aus Gründen der Fairness und der Integrität des EU-Binnenmarktes brauche es daher zwingend einen übergeordneten Rahmen.
EU-Vorsitzender Schwab: «Nicht die Bürger sollten Leiden»
Andreas Schwab, Vorsitzender der Delegation des EU-Parlaments für die Schweiz, verwies auf das in der EU geltende Prinzip der Nicht-Diskriminierung: «Alle Bürger, die am EU-Binnenmark teilnehmen, haben die gleichen Rechte», kritisierte der aus Süddeutschland stammende Schwab den Abbruch-Entscheid des Bundesrates. Viele EU-Abgeordnete stiessen ins gleiche Horn wie Schwab.
«Nun sollten aber nicht die Bürger unter der unglücklichen Entscheidung leiden», sagte Schwab weiter. «Daher sollte der Schweiz in Angebot für ein Übereinkommen zur Forschung und Bildung unterbreitet werden.» Dies auf der Basis der vollständigen Umsetzung der bereits bestehenden Abkommen wie dem Freizügigkeitsabkommen.

Dabei dürfte der konservative Politiker etwa auf Kroatien anspielen. Kroatische Bürgerinnen und Bürger profitieren noch nicht voll von der Personenfreizügigkeit in der Schweiz.
Die aus Österreich stammende liberale EU-Abgeordnete Claudia Gamon sagte, es brauche «ein Update unserer gemeinsamen Verträge». Doch sie kritisierte: «Jetzt zuzuschauen, wie ein Abkommen nach dem anderen ausläuft. Wie man keine neuen Kooperationen schliessen kann. Und wie sich unsere Verbindungen mit der Schweiz nach und nach langsam auflösen werden, ist ganz sicher keine Alternative.»
Grünen-Abgeordneter Giegold kritisiert Schweiz
Als «keine gute Nachricht» bezeichnete auch der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold den Abbruch der Verhandlungen. Dabei sparte er nicht mit Kritik an der Schweiz.

Gleichzeit sagte er aber, die EU müsse sich fragen lassen: «warum man so scharfe Anforderungen im Bereich des Arbeitsmarktes gestellt hat. Denn wahrlich sind die sozialen Regeln im europäischen Binnenmarkt nicht vorbildlich.»
Ähnliche Kritik äusserte auch die deutsche Sozialdemokratin, Evelyne Gebhardt. Sie sehe «mit Befremden», wie stark sich die EU-Kommission gegen die sehr guten Arbeitsmarkt-Schutzmassnahmen in der Schweiz gestellt habe.
Handelskrieg müsse verhindert werden
Laut Giegold muss nun ein schleichender Handelskrieg verhindert werden und: «Schritt für Schritt da, wo die Notwendigkeiten einer Kooperation am wichtigsten sind, massgeschneiderte Lösungen zu finden.»
Applaus erhielt die Schweiz vor allem aus nationalkonservativen, EU-kritischen und rechtspopulistischen Kreisen. So lobte beispielsweise der EU-Abgeordnete Michiel Hoogeveen aus den Niederlanden den Verhandlungsabbruch der Schweiz. Er bezeichnete dies als eine Reaktion auf die «imperialistischen Ansätze der Kommission».
Der dänische EU-Abgeordnete Peter Kofod gratulierte der Schweiz dafür, «dass es kein Ergebnis gegeben hat». Er forderte mit Verweis auch auf den Brexit die EU-Kommission, dazu auf «sich darüber Gedanken» zu machen.












