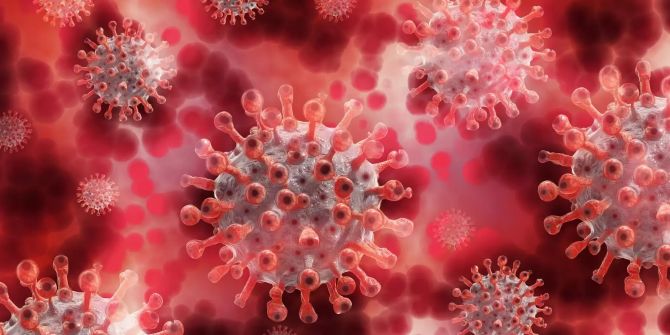Berner CoV-2-Modell beschleunigt Forschung und Arzneientwicklung
Wissenschaftler aus Bern und New York haben ein Modell von SARS-CoV-2 entwickelt. Dadurch beschleunigt sich die Forschung an dem Virus.

Das Wichtigste in Kürze
- Wissenschaftler aus Bern und New York haben ein CoV-2-Modell entwickelt.
- Die Forschung am Virus und den neuen Varianten wird durch dieses beschleunigt.
- Mit dem realistischen System lassen sich ausserdem Medikamente besser prüfen.
Wissenschaftler aus Bern und New York haben ein nicht-ansteckendes Modell von SARS-CoV-2 entwickelt. Dieses beschleunigt die Forschung am Virus und seinen neuen Varianten und macht diese sicherer. Zudem lassen sich mit dem realistischen Modell Medikamente besser testen. Die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten ist weltweit schon weit gediehen.
Aber es können immer wieder Varianten auftauchen, die noch infektiöser sind. Vor welchen die vorhandenen Impfstoffe sogar nicht oder ungenügend schützen. «Je schneller die Eigenschaften solcher Varianten charakterisiert werden können, desto schneller lassen sich Gegenmassnahmen ergreifen.» Dies schreibt die Universität Bern (Unibe) in einer Mitteilung vom Freitag.
Die Gefahren des Virus
Ein Aspekt, der die Arbeit am Virus bisher verlangsamte, war die hohe biologische Sicherheit, die im Labor gewährleistet werden muss. Die gebotene Vorsicht schliesst bestimmte Experimente sogar aus. Zu diesen Experimenten gehört etwa das genetische Screening von Zellbestandteilen, die für die Virusinfektion und Vermehrung unerlässlich sind. Sie stellen daher einige der besten Angriffspunkte für Medikamente dar.
Die Forscher waren unter der Leitung Charles Rice von der Rockefeller University und Volker Thiel von der Universität Bern. Sie bedienten sich eines Tricks, um die Gefahren des Virus im Labor zu entschärfen: Sie teilten es gleichsam in zwei Komponenten auf, das Spike-Protein und die «Vermehrungsmaschinerie» des Coronavirus'.
Der Trick besteht darin, dass sie das gesamte Coronavirus-Genom ohne das Spike-Protein im Labor zusammensetzten. Zusätzlich führen sie einen zweiten «Bauplan», mit dem das Spike-Protein hergestellt wird, in die Zellen ein. Einmal in die Zellen eingebracht, kann der «spike-lose» Coronavirus-Bauplan alle Schritte des viralen Lebenszyklus durchlaufen. Jedoch kann er keine neuen infektiösen Coronavirus-Partikel produzieren.
Kein Spike-Bauplan vorhanden
Was sie produzieren, sind virenähnliche Partikel ohne Spike-Bauplan. Diese können dann verwendet werden, um andere Zellen zu infizieren und so eine natürliche Infektion nachzuahmen.
Diese neu infizierten Zellen verfügen ebenfalls nicht über den Bauplan für das Spike-Protein. Deshalb können diese selber keine neuen infektiösen Viruspartikel produzieren. Dadurch sind im Labor weniger Vorsichtsmassnahmen vonnöten und das beschleunigt die Arbeit.
Gleichartige Modelle
Ähnliche Systeme habe es schon früher gegeben, es handelte sich jedoch bei dem dabei separierten Protein nicht um das Spike-Protein. Der Vorteil der neuen Methode liege darin, dass mit dem Spike-Protein eine besonders schädliche Komponente besser untersucht werden könne: «Mutationen des Spike-Proteins gaben bisher den grössten Anlass zur Sorge über neue Varianten», erklärt Thiel.
Während das gesamte SARS-CoV-2-Genom 30'000 Buchstaben aufweist, verfügt der genomische Bauplan des Spike-Proteins nur über deren 5000. Das macht es leichter handhabbar.
Am entschärften Modell wirken antivirale Medikamente ähnlich wie beim gefährlichen Original, schreiben die Forscher: Bereits vorhandene antivirale Medikamente hätten das Modell genauso blockiert wie das originale Virus. «Damit kann das Modell auch dazu verwendet werden, neue Wirkstoffe zu testen – allerdings unter wesentlich sichereren Bedingungen», sagt Thiel.