Nach Krawall-Demo: Braucht Bern wieder eine Stadtpolizei?
Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es keine Berner Stadtpolizei mehr. Bei Ausschreitungen wie vor zwei Wochen steht trotzdem die Stadt in der Verantwortung.

Das Wichtigste in Kürze
- Nach Ausschreitungen in Bern folgt jeweils Kritik an den städtischen Behörden.
- Doch diese sind in der Zwickmühle: Ein eigenes Polizeikorps können sie nicht befehligen.
- Immer wieder werden Stimmen laut, die eine Rückkehr zur Stadtpolizei fordern.
Nicht zum ersten Mal stehen nach Ausschreitungen in Bern auch die Stadtbehörden und die Polizei in der Kritik. So auch nach der Eskalation an der Pro-Palästina-Demo vor zwei Wochen. War man zu wenig gut – oder gar falsch – vorbereitet?
Oder besteht ein ganz anderes Defizit: Dass die Stadt Bern seit fast zwei Jahrzehnten kein eigenes Polizeikorps mehr hat.
Seit Anfang 2008 gibt es nur noch die Kantonspolizei Bern. Sei es für bewilligte und unbewilligte Kundgebungen, Cup-Final-Fanmärsche oder nur schon den Zibelemärit. Der städtische Sicherheitsdirektor ist bei Polizei-Einsätzen also nur Bittsteller beim Kanton.
Zurück zur Stadtpolizei?
«In der Tat würde ich es sehr begrüssen, wenn die Stadtpolizei wieder eingeführt würde», sagt AL-Stadtrat David Böhner. Ihm wäre wichtig, dass die volle Verantwortung für die Polizei auf Gemeindegebiet bei den Stadtbehörden wäre. Denn bei Demonstrationen funktioniere die Rollenteilung nicht.
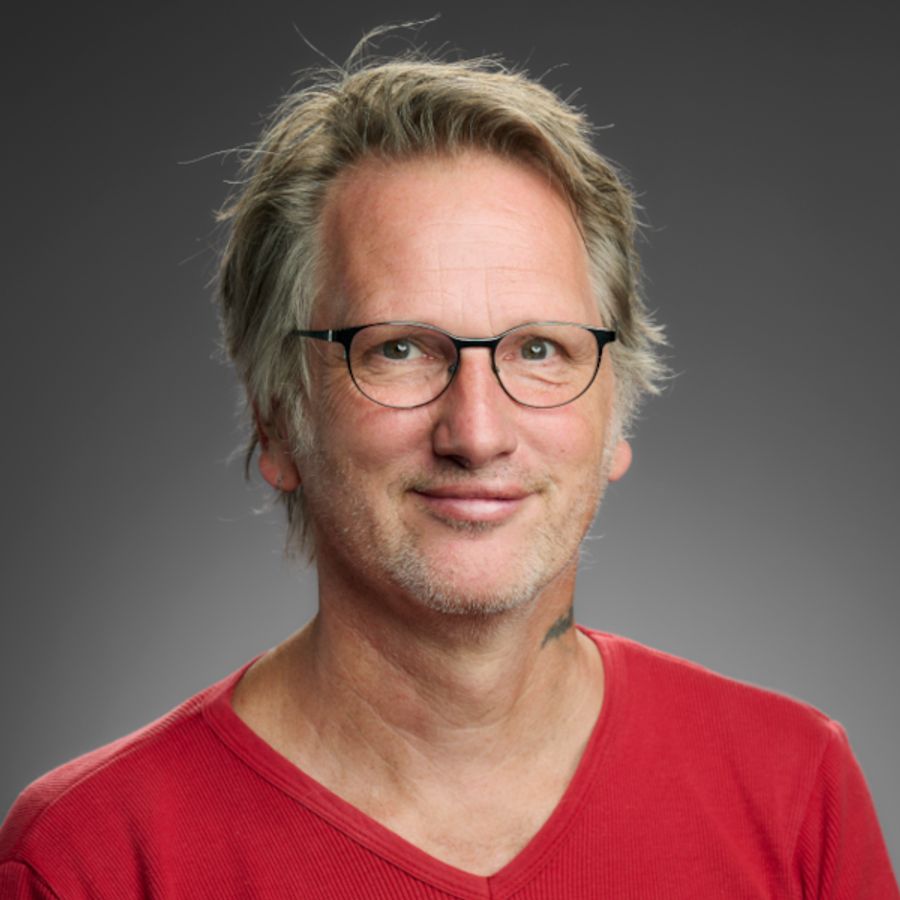
«Der städtische Sicherheitsdirektor kann laut Vertrag strategische Vorgaben für den Polizeieinsatz geben. Ob er davon Gebrauch macht, ist nicht bekannt», so Böhner.
Er kritisiert, dass es diesbezüglich keine Transparenz gebe. «Alle Absprachen geschehen in Hinterräumen.»
Kritik an Stadtpolizei: Doppelspurigkeiten und Mehrkosten
Nein, eine Stadtpolizei brauche es nicht, ist dagegen die klare Ansage bei der FDP. Die Kantonspolizei sei etabliert, sagt Stadträtin Simone Richner: «Eine Rückkehr zu einer Stadtpolizei würde Doppelstrukturen, Kompetenzkonflikte und erhebliche Mehrkosten verursachen – ohne erkennbaren Sicherheitsgewinn.»
Keine Veranlassung für eine Änderung sieht auch SVP-Stadtrat Alexander Feuz. Er sieht den Fehler so oder so woanders: Dass der Gemeinderat aus politischen Gründen nicht eingreifen und auch militanten Demonstranten immer zuerst noch eine Chance geben wolle. «Muss zuerst die Stadt abbrennen oder muss es Tote geben, bis der Gemeinderat die Polizei ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen lässt?»

SVPler Feuz äussert gar einen Verdacht: «Liegt es etwa daran, dass Angehörige und Freunde des Gemeinderats im schwarzen Block mitmarschieren?»
Pragmatischer fasst es Mitte-Stadträtin Béatrice Wertli: Eine eigene Stadtpolizei sei «wie ein zweites Postauto auf derselben Linie – doppelt gefahren, doppelt bezahlt, aber kein bisschen schneller.»
Zudem sieht sie Abgrenzungsprobleme mit den de facto zusammengewachsenen Nachbargemeinden Köniz, Ostermundigen oder Muri. Dort wäre gar nicht klar zu definieren, wo die Zuständigkeit einer städtischen Polizei endet.

Ähnlich wie ihre bürgerlichen Kollegen sehen es auch die Grünliberalen. Stadträtin Janina Aeberhard sieht hingegen – wie auch die FDP – trotz allem Verbesserungspotenzial:
Nämlich insbesondere bei der Kommunikation, aber auch der Einsatzplanung und Nachbearbeitung. Dort setze man auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton.
Linke orten Verbesserungspotenzial bei Kantonspolizei
Eine Stadtpolizei begrüssen, würde dagegen das Grüne Bündnis, sagt Stadträtin Lea Bill. Denn: «Wir bemängeln seit Jahren, seit dem Wechsel von der Stadt- zur Kantonspolizei, die fehlende demokratische Kontrolle.»
Diese sei zwar rechtlich möglich, werde vom zuständigen Gremium – der Grossratskommission – aber nicht wahrgenommen.
Zwar habe der Gemeinderat die Kompetenzen, auf strategischer Ebene auf das Vorgehen der Kantonspolizei einzuwirken. «Es ist schwierig zu sagen, inwiefern diese Möglichkeit tatsächlich genutzt wird.»

«Links» mit «pro Stadtpolizei» gleichzusetzen, stimmt allerdings nur bedingt. Bei der SP hält Stadtrat Dominic Nellen zunächst fest: Die Position der SP Stadt Bern habe keinen Zusammenhang mit der kürzlichen Demo. Ob Stadt- oder Kantonspolizei hätte bezüglich der Ausschreitungen wohl auch keinen Unterschied gemacht.
Hingegen wünscht sich die SP «eine bürgernahe Polizei», mit einer klaren politischen Steuerung. Und, wie das Grüne Bündnis, einer demokratischen Kontrolle.
«Aus Sicht der SP Stadt Bern erfüllt die Kantonspolizei diese Anforderungen in ihrer heutigen Form nur unzureichend», so Nellen.
Ex-Sicherheitsdirektor Nause: Es geht nur mit Kantonspolizei
Für GFL-Stadtrat Michael Ruefer steht ein Verdacht im Raum: «Dass die Polizei bisweilen zu einem Spielball des bürgerlich dominierten Kantons in seinem ‹Rachefeldzug› gegen die rot-grün dominierte Stadt wird.»
Politische Spielchen dürften aber nicht auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen werden, betont Ruefer.
Denn, so Ruefer weiter: Die Arbeit der Polizei – auch als Teil der Kantonspolizei – funktioniere in der Stadt Bern grundsätzlich gut. Bern sei eine sichere Stadt und gleichzeitig fühle man sich nicht «überwacht».

Er gibt zudem zu bedenken, dass eine Rückkehr zu einer Stadtpolizei auf kantonaler Ebene angestossen werden müsste. Das sei aufgrund der Mehrheitsverhältnisse aber sehr unwahrscheinlich.
Mit der grundsätzlichen Zufriedenheit und den rechtlichen Hürden kommt GFL-Stadtrat Ruefer deshalb zum Schluss: «Der Ruf nach einer Stadtpolizei ist also mitunter polemisch.»
Bliebe die Frage, was denn die zuständigen Personen eigentlich dazu sagen. Der aktuelle Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried hat sich in der Diskussion um die Stadtpolizei bislang zurückhaltend geäussert.
Mit mehr Erfahrung und weniger politischen Einschränkungen äussern kann sich dagegen der Vorgänger und Mitte-Nationalrat Reto Nause. Er hat das Amt des städtischen Sicherheitsdirektors immerhin während 16 Jahren ausgeübt.

Nause kehrt den Spiess um: Gerade die Ereignisse in Bern zeigten, dass die Einheitspolizei ein wichtiger Schritt gewesen sei. Er weist darauf hin, dass auch diverse ausserkantonale Polizeikorps im Einsatz waren. «Als Stadtpolizei liesse sich ein solches Ereignis gar nicht mehr bewältigen.»
«Mit über 530 Anhaltungen konnten so viele Gewaltextremisten wie nie identifiziert werden», betont Nause. Doch nur schon die Abarbeitung dieser Personen sei mit extremem Aufwand verbunden.








