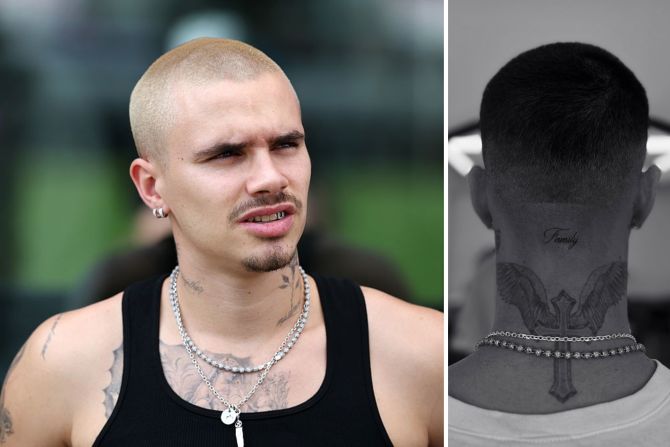«Come on, Come on»: Joaquin Phoenix in Schwarz-Weiss
Mike Mills kredenzt dem Kinopublikum einen so elegant gefilmten wie leichtfüssigen und herzerwärmenden Roadtrip, bei dem es dennoch stets um die grossen Fragen geht.

Das Wichtigste in Kürze
- Was gibt es Schöneres, als Kindern Zeit zu schenken, Zeit und Aufmerksamkeit? Viele Kinder und Jugendliche kommen in dem in distinguiertem Schwarz-Weiss gehaltenen Spielfilm «Come on, Come on» zu Wort.
Befragt werden sie von Joaquin Phoenix. Er gibt hier einen New Yorker Radiojournalisten, der sich auf seinen Reisen durch die Vereinigten Staaten den Ängsten, Wünschen, Vorstellungen von Kindern widmet. Mit kleinem Team und grossem Mikro, das er den stets auskunftsfreudigen Kids unter die Nase hält, ist der grau-melierte, leicht füllige Reporter unterwegs. Dass er auf einer dieser Reisen vom neunjährigen Sohn seiner Schwester begleitet wird, stellt den ansonsten ziemlich relaxt wirkenden Mann vor einige Herausforderungen. Die Regie zu diesem rührenden Film kommt vom Kalifornier Mike Mills («Jahrhundertfrauen», «Thumbsucker»).
Nicht lang ist es her, dass Johnny (Phoenix) und seine Schwester den Tod der Mutter haben verkraften müssen. Immer noch hat Johnny ein schlechtes Gewissen: Fragt sich und seine Schwester, ob es sein könne, dass er nicht «richtig» trauere, zu viel arbeite. Und er ist wohl tatsächlich recht viel unterwegs für dieses grosse, dieses wunderbare Radioprojekt, das den Kleinsten der Gesellschaft so viel an Aufmerksamkeit einräumt: Hier dürfen sie sich alles mal von der Seele, und dabei aber auch allen Erwachsenen ins Gewissen reden: Es geht um Einsamkeit, ums Nicht-Verstanden-Werden, um manch anderes Thema. Einmal heisst es: «Die Erde stirbt». Und doch hat dieser Film zu keinem Zeitpunkt etwas Anklagendes, nie etwas von einem Appell; dafür fliesst «Come on, Come on» einfach auf viel zu angenehme Art und Weise dahin.
So unaufgeregt der Film anmutet, so viele kleine Überraschungen und Ideen hält er doch parat: Hübsch etwa der Einfall, all die Bücher, aus denen Johnny seinem Neffen Jesse vorliest (oder in denen er selbst blättert), als eine Art Zwischentitel einzublenden: Einmal geht es, wohl nicht ganz ohne Grund, um einen bipolaren Polarbären; Jesses Vater hat psychische Probleme. Er ist der Grund, warum Johnny von seiner Schwester darum gebeten wird, sich eine Weile um ihren Sohn Jesse (stark: Woody Norman) zu kümmern. Auf ganz verschiedenen Wegen kommen sich Neffe und Onkel (eine im Kino gar nicht mal so häufig zu beobachtende Kombination) immer näher – mal über Rollenspiele, mal übers Herumalbern.
Dass sich die beiden bei allen Schwierigkeiten (Jesse büxt inmitten grosser Städte und Menschenansammlungen gern einfach mal aus) immer besser verstehen, dass sich zwischen Onkel und Neffe fast so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung, fast so etwas wie eine Freundschaft entspinnt, das liegt nicht nur am Drehbuch (ebenfalls: Mike Mills), sondern auch am höchst glaubwürdigen Spiel der Hauptdarsteller. Phoenix, der hier gefühlte 50 bis 60 Kilogramm mehr mit sich herumträgt als in seiner Paraderolle als Joker (im 2019er Film von Todd Phillips), Phoenix passt wunderbar in die Rolle des New Yorker Journalisten, der sich bei aller Grizzlybär-Haftigkeit im Habitus doch ein gutes Stück an kindlicher Naivität und Freude hat bewahren können.
Mehrmals zeigt uns Mills Bilder aus Vogelperspektive: Ein kalifornischer Highway, Automassen in New York. Alles in Schwarz-Weiss, alles in Zeitlupe. Das gibt dem Film etwas Zeitloses, fast Poetisches. Die hypnotische, famose Musik der Brüder Aaron und Bryce Dessner von der Band The National tut, im Zusammenspiel mit der wunderbar leichthändigen Montage, ein Übriges: Langsam versinkt man in diesem Film wie in einem angenehm weichen Sofakissen. Was umso erstaunlicher ist, als es hier doch um einen Film geht, der Themen verhandelt wie Zukunftsangst, Verlust, Trauer, unsere Umwelt, Erziehungsprobleme, den oft unüberbrückbar erscheinenden Gegensatz zwischen Erwachsenen und Kindern.
Ob sie Hoffnungen habe, was die Zukunft angeht, wird ein junges Mädchen einmal gefragt. Die Antwort ist so ernüchternd: Nein, so wie die Erwachsenen ticken, wird es wohl nicht besser werden. Und so kann man diesen schönen Film als Plädoyer dafür lesen, was ein Erich Kästner einst so formulierte: «Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch».