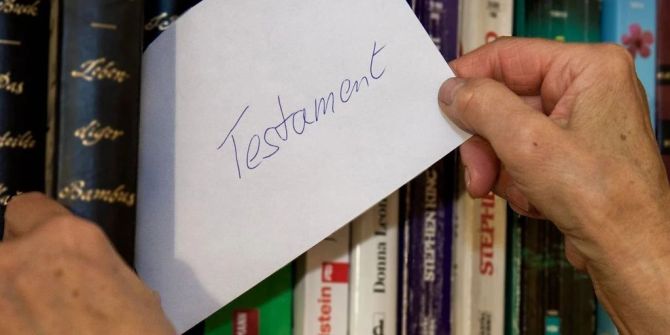Eine für Orang-Utans etwas rasante Famielienplanung
Hier die freudige Geburt eines weiteren Ambassadors, dort die wichtige Unterstützung des Orang-Utan-Schutzprogramms der Stiftung PanEco auf Sumatra.

Orang-Utans sind Bewohner des Kronendachs der Regenwälder von Sumatra und Borneo. Sie sind die grössten Säugetiere, die sich in diesem Bereich des Waldes aufhalten.
Und dies ohne «Netz»: Um sicheren Halt in dieser Höhe zu haben – die Weibchen wiegen um die 40, die Männchen um die 80 Kilogramm – sind sowohl die Hände wie die Füsse als Greiforgane ausgebildet. So setzen die Tiere beim Hangeln und Futter suchen im Geäst immer mindestens eine Hand oder ein Fuss als Sicherungspunkt ein.
Variables Nahrungsangebot
Die Pflanzengesellschaften des Regenwaldes sind wohl artenreich, das Nahrungsangebot für die Orang-Utans im Kronenbereich ist jedoch grossen Schwankungen unterworfen. Reifende Früchte in grossen Bäumen etwa bieten temporär einen reich gedeckten Tisch, an den sich gleich mehrere Orang-Utans «setzen» können.
Dann aber folgen Phasen, in denen nur noch ein knappes Futterangebot aus Rinde und Blättern besteht und die Tiere einzeln oder mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind. Dieses räumlich und zeitlich variierende Futterangebot verhindert, dass Orang-Utans dauerhaft in Gruppen leben können.
Langer Weg zur Selbstständigkeit
Menschenaffen haben – nicht unähnlich zum Menschen – eine geringe Fortpflanzungsdynamik. Die Tragzeit ist mit gegen neun Monaten lang, die Jungtiere entwickeln sich langsam und erreichen erst spät ihre Unabhängigkeit.
Diese Merkmale sind gerade beim Orang-Utan ausgeprägt. Die Jungtiere werden mit etwa drei Jahren entwöhnt, bleiben dann aber noch ein paar weitere Jahre bei der Mutter, um sich all das räumliche und ökologische Wissen anzueignen, das es braucht, um in ihrem komplexen Lebensraum überleben zu können.
Unerwartet rascher Zuwachs im Bestand der Zürcher Gruppe
Elf Tiere umfasst aktuell der Bestand an Sumatra-Orang-Utans im Zoo Zürich, zur Zeit der grösste in einem europäischen Zoo. Ein älteres Weibchen lebt alleine, die anderen – wenn auch Orang-Utans meist als Einzelgänger unterwegs sind – in einer Gruppe.
Nebst dem grossen Zuchtmann Djarius sind das Timor mit ihren beiden erwachsenen Töchtern Xira und Cahaya und der jüngeren Tochter Mimpi sowie fünf Enkelkinder. Das jüngste Enkelkind kam am 4. Februar zur Welt und ist die Tochter von Cahaya (als Vater kommen Djarius und der 13-jährige Hadiah, Sohn von Xira, in Frage).
Dieser Nachwuchs war nicht erwartet worden. Nicht dass man die Schwangerschaft von Cahaya übersehen hätte, vielmehr war die Möglichkeit dieser Schwangerschaft nicht erwartet worden.
Solange eine Orang-Utan-Mutter ein Jungtier säugt, und das ist etwa während drei Jahren der Fall, sorgt in der Regel eine Laktationsamenorrhö dafür, dass es nicht zu einem Eisprung kommt. Geburtsintervalle von vier bis fünf Jahren, oft gar sechs bis acht Jahren oder mehr sind bei Orang-Utans üblich – im Freiland haben Sumatra-Orang-Utans die längsten Geburtsintervalle aller Säugetiere.
Der zweitjüngste Spross von Cahaya, Tochter Riang, wurde im Juni 2017 geboren. Ihre jüngere Schwester Utu («Floh») hat nun das übliche Geburtsintervall mit knapp 20 Monaten deutlich unterschritten.
Für Cahaya stellt sich die Herausforderung, die sich in ihrem Fell festklammernde Tochter Utu zu betreuen und gleichzeitig aber auch auf die schon recht selbstständige Riang einzugehen, die zwischendurch die Aufmerksamkeit ihrer Mutter einfordert und auch noch gesäugt werden möchte. Bisher galt im Zuchtprogramm die Empfehlung, dass für die Beeinflussung der Geburtsintervalle 30 Monate nach der letzten Geburt mit der Verabreichung der Pille begonnen werden sollte. Diese Empfehlung muss wohl überdacht werden …
Als «vom Austerben bedroht» eingestuft
Knapp 150 Sumatra-Orang-Utans leben in 27 europäischen Zoos. Ihre Zucht wird im Rahmen eines Erhaltungszucht-Programms koordiniert.
Dieser Bestand hat sich in den letzten 15 Jahren kaum verändert. Die langsame Populationsdynamik der Orang-Utans bedeutet auch, dass Verluste nicht schnell ausgeglichen werden können.
Verluste erleiden die wildlebenden Orang-Utan-Populationen insbesondere durch Lebensraumverlust wie etwa bei der Umwandlung von Regenwald in Ölpalmplantagen oder durch Holzschlag. Strassen zerschneiden die Lebensräume zusätzlich.
Weiter werden den Populationen immer noch illegalerweise Jungtiere zur Haltung als «Haustiere» entnommen. Die Internationale Naturschutz-Union IUCN stuft den Sumatra-Orang-Utan als «vom Aussterben bedroht» ein, aufgrund der massiven und rasanten Lebensraumverluste und des damit einhergehenden Populationsrückgangs in den letzten 35 Jahren.
Deshalb sind Lebensraumschutz und die Betreuung konfiszierter und verletzter Orang-Utans und deren Auswilderung in intakte Lebensräume zentrale Massnahmen zum Schutz der weiterhin schrumpfenden Bestände. Der Zoo Zürich unterstützt als eines seiner zentralen Naturschutzprojekte die vor Ort tätige Stiftung PanEco bei diesen Aktivitäten.