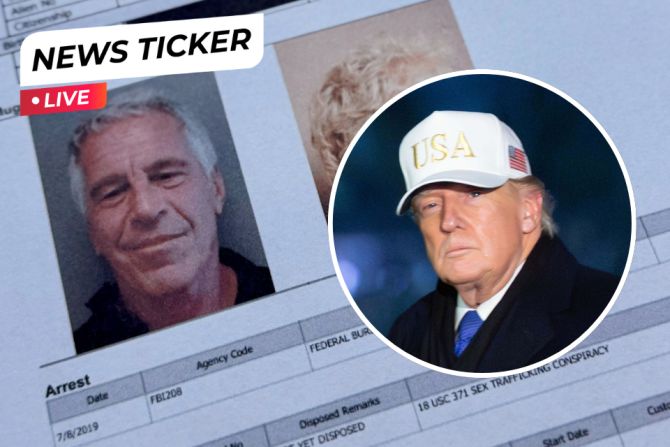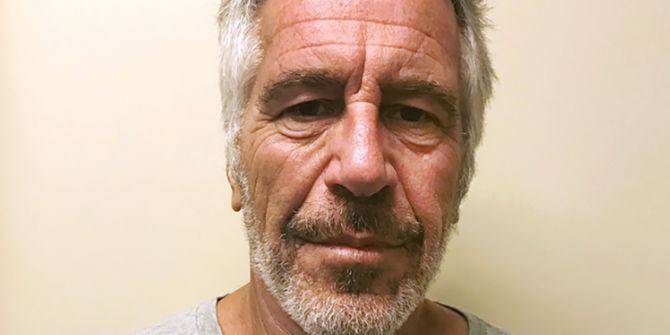Genfer Chirurgen weisen Patienten ab
Hand-Spezialisten in Genf reichen momentan all ihre nicht akuten Patienten ans Spital weiter. Sie protestieren mit dieser Aktion gegen die Anfangs Jahr gesenkten Tarmed-Tarife.
Seit Anfangs Jahr gelten die vom Bundesrat eingeführten tieferen Tarmed-Tarife. Dabei handelt es sich um die Summe, die Ärzte und Spitäler für ambulante Leistungen verlangen dürfen. Der ewige Streit zwischen Krankenkassen, Spitäler und Ärzten ist mit der Senkung aber noch nicht vorüber: Genfer Handchirurgen weigern sich nun, Patienten zu behandeln. Sie nähmen nur noch Notfälle an. Die restlichen Personen müssen derzeit in ein Spital.
Patientenschutz empört
Am 23. Februar trifft sich die Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung. Dort besprechen die Mediziner das weitere Vorgehen.

«Patienten dürfen unter einem Ärzte-Streik nicht leiden», sagt Susanne Hochuli, Präsidentin der Schweizerischen Stiftung Patientenschutz (SPO), gegenüber Nau. «Sie können sich zu den Tarmed-Tarifen ja auch nicht äussern.» Die SPO befürchtet, dass die Problematik auch auf die andere Seite kippen könnte. Nämlich dass viele Spitäler die neuen Tarife zu optimieren versuchen: Da es für die einzelnen Leistungen weniger Geld gibt, rechnen die Ärzte einfach mehr Leistungen ab oder machen überflüssige Behandlungen. «Das Ganze soll nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden», so Hochuli.
Das Wichtigste in Kürze
- Handchirurgen in Genf protestieren gegen die tiefen Tarmed-Tarife.
- Seit anfangs Jahr müssen die Mediziner weniger verlangen für ambulante Leistungen.
- «Das Ganze soll nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden», sagt der Patientenschutz.
500 Operationen wurden auf unbekannte Zeit verschoben, sagt der Genfer Handchirurg Stéphane Kämpfen gegenüber der Zeitung «La Liberté». Bis zu 40 Prozent Einnahmen büssen die Chirurgen mit den neuen Tarifen im Vergleich zu früher ein, schreibt die «NZZ».