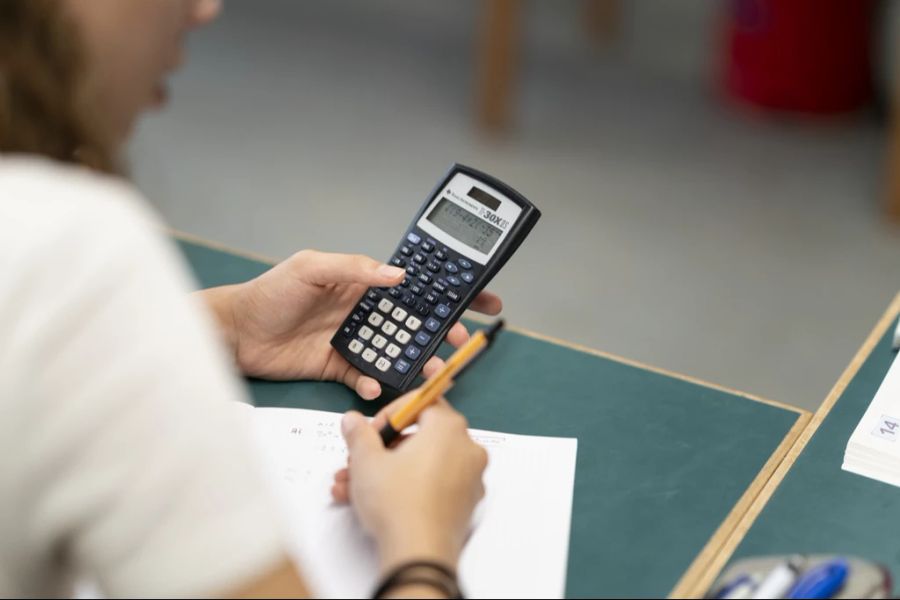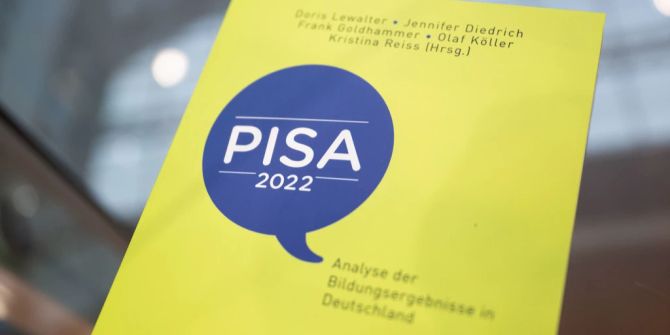840'000 Menschen in der Schweiz können schlecht lesen und rechnen
Etwa 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung im Alter von 16 bis 65 Jahren hat Schwierigkeiten beim Lesen, Rechnen und Problemlösen ohne direkte Anleitung.
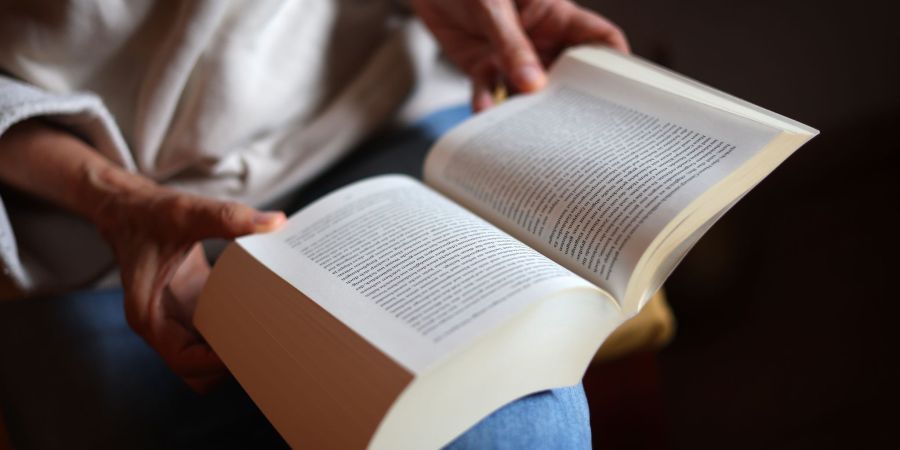
Das Wichtigste in Kürze
- 15 Prozent der Schweizer zwischen 16 und 65 haben Probleme beim Lesen, Rechnen und Denken.
- Das sind etwa 844'000 Menschen in der Schweiz.
- Sie verdienen meist weniger und sind seltener berufstätig.
15 Prozent der Schweizer Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren haben Mühe beim Lesen, Rechnen und Problemlösen ohne direkte Handlungsanweisung.
Das sind etwa 844'000 Menschen. Tendenziell verdienen sie weniger und sind seltener erwerbstätig als die Gesamtbevölkerung.
Zudem sind ihr Wohlbefinden und ihre Teilnahme am sozialen Leben niedriger als bei Personen mit höheren Kompetenzen. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag aufgrund der OECD-Evaluation der Kompetenzen von Erwachsenen (Piaac) mit.
Von den Erwachsenen mit geringen Kompetenzen haben 46 Prozent demnach keine nachobligatorischen Bildungsabschluss.
56 Prozent von ihnen finden sich in der Altersgruppe zwischen 46 und 65 Jahren. Mit 7 Prozent lag ihre Arbeitslosigkeit höher als in der Gesamtbevölkerung (2 Prozent).
Bildungshintergrund der Eltern beeinflusst Kompetenzen
Gemäss dem BFS könnte die fehlende Kompetenzentwicklung sozioökonomische und familiäre Hintergründe haben: Lediglich 12 Prozent der Eltern dieser Menschen hatten höhere Bildungsabschlüsse gegenüber 34 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Zudem verfügten nur 25 Prozent der Eltern von Personen mit schwächeren Kompetenzen über eine Berufsqualifikation. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 52 Prozent. Ausserdem waren diese Eltern mit 7 Prozent häufiger arbeitslos.
Die Piaac-Evaluation der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) misst die Fähigkeiten in den jeweiligen Landessprachen. Dennoch sind nicht nur Fremdsprachige von Kompetenzschwächen betroffen, wie das BFS schrieb.
Von den Menschen mit mangelnden Kompetenzen sprechen 38 Prozent eine Landessprache als Hauptsprache.
62 Prozent der übrigen Personen nahmen die Piaac-Tests in einer Fremdsprache ab. Das erklärt teilweise ihre niedrigeren Kompetenzen und wirkt sich auf ihre Ergebnisse aus.
Geringe Kompetenzen bedeuten oft weniger Arbeit
71 Prozent der Personen mit geringeren Kompetenzen sind erwerbstätig gegenüber 83 Prozent der Gesamtbevölkerung. Über 80 Prozent von ihnen gehören dabei zu den 40 Prozent mit den tiefsten Einkommen.
Sie beziehen häufiger Sozialleistungen und verrichten häufiger körperliche Arbeit. So arbeiten 66 Prozent von ihnen täglich längere Zeit körperlich, in der Gesamtbevölkerung beträgt dieser Anteil 34 Prozent. Damit einher geht auch weniger Selbstbestimmung im Beruf, etwa bei der Organisation der Arbeit oder den Arbeitszeiten.
86 Prozent der Bevölkerung sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Bei Personen mit geringeren Kompetenzen liegt dieser Anteil nur bei 75 Prozent. Ausserdem schätzen nur 38 Prozent von ihnen gegenüber 55 Prozent der Gesamtbevölkerung die eigene Gesundheit als sehr gut ein.
Weniger Vertrauen und Engagement bei weniger Kompetenten
33 Prozent der weniger Kompetenten haben starkes Vertrauen in ihre Mitmenschen, verglichen mit 47 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das freiwillige Engagement liegt bei ihnen bei 19 Prozent, während es in der Gesamtbevölkerung 37 Prozent beträgt.
Nur 33 Prozent der weniger gut Gebildeten schätzen ihre politischen Mitsprachemöglichkeiten als hoch oder sehr hoch ein. Bei der Gesamtbevölkerung sind es hingegen 51 Prozent.
Weniger Weiterbildung bei geringeren Kompetenzen
61 Prozent der Bevölkerung haben in den fünf Jahren vor der Erhebung eine Weiterbildung absolviert. Dies zeigt die Statistik der letzten Jahre. Bei Menschen mit geringeren Kompetenzen erreicht der Wert 33 Prozent.
Dabei unterscheiden sich die Gründe: 33 Prozent der Personen mit geringeren Kompetenzen sehen in der Weiterbildung konkrete Berufs- und Karrierechancen. In der Gesamtbevölkerung sind es dagegen nur 21 Prozent.
Bei der übrigen Bevölkerung bildet bei 29 Prozent das persönliche Interesse die Hauptmotivation. Von jenen mit geringeren Kompetenzen geben dies 19 Prozent als Grund an.
Das internationale Programm zur Evaluation der Kompetenzen von Erwachsenen erfasst wichtige Fähigkeiten. Diese sind angesichts des technologischen und digitalen Wandels besonders notwendig.
Konkret erfasst Piaac die Lese-, Rechen- und adaptiven Problemlösungskompetenzen. Die Schweiz ist beim zweiten Zyklus seit 2021 dabei.
Geringe Rechenkompetenz bleibt auf niedrigstem Niveau
Geringe Kompetenzen im Lesen bedeuten etwa, dass die Betroffenen nicht in der Lage sind, einen sehr einfachen Text zu verstehen. Im Rechnen kommen sie nicht über das tiefste Niveau hinaus.
Beim sogenannten adaptiven Problemlösen geht es um die Fähigkeit, ein Ziel auch dann erreichen, wenn unmittelbar keine Methode dafür vorliegt. Beispiele dafür sind etwa die Organisation von Reisen zusammen mit anderen oder das Steuern von Produktionsanlagen.