Netflix: So realistisch sind die Sci-Fi-Szenarien aus «Black Mirror»
Gehirnimplantate und Computer, die Wirklichkeit verändern: Könnten die Erfindungen aus der neuen «Black Mirror»-Staffel auf Netflix tatsächlich Realität werden?

Das Wichtigste in Kürze
- Kürzlich ist die siebte Staffel von «Black Mirror» erschienen.
- Die Sci-Fi-Serie thematisiert die möglichen negativen Auswirkungen von Technologien.
- Nau.ch macht bei drei der neuen Episoden den Realitätscheck.
Wenn «Black Mirror» in unsere nahe Zukunft blickt, fällt das Ergebnis meist düster aus. In der Science-Fiction-Serie werden Gehirne in Clouds gespeichert, Grenzen zwischen Mensch und Maschine verwischt und virtuelle Welten lösen Schmerz aus.
Kürzlich ist die siebte Staffel auf Netflix gestartet. Wie wirklichkeitsnah sind die neuen Technologien und Szenarien?
Das dürften sich auch viele Schweizerinnen und Schweizer fragen: Hierzulande gehört die neue «Black Mirror»-Staffel auf Netflix derzeit zu den Top zehn beliebtesten Sendungen.
Nau.ch hat drei Episoden ausgewählt und sie mithilfe dreier Forscher mit der Realität abgeglichen. Die Experten erklären, was heute schon möglich ist, was vielleicht bald kommt – und was (zum Glück) reine Fiktion bleibt.
Achtung: Ab hier wird gespoilert!
Folge 1: Gehirn-Streaming mit Abo-Falle
Als Amanda wegen eines Hirntumors ins Koma fällt, wendet sich ihr Mann Mike an Rivermind. Das Neuro-Start-up holt Amanda mittels Hightech-Verfahren zurück ins Leben.
Das funktioniert ungefähr so: Vom betroffenen Gehirnteil wird eine Art Backup-Klon auf dem Cloud-basierten Server von Rivermind erstellt.
Anschliessend wird die beschädigte Region entfernt und durch synthetisches Empfängergewebe ersetzt. So können Amandas kognitive Funktionen vom Backup über die Cloud in ihr Gehirn übertragen werden.

Während die Operation kostenlos ist, sind die «Streaming-Gebühren» an ein perfides Abo-Modell geknüpft, das sich laufend ändert. Das bringt das Paar bald in finanzielle Nöte.
So plappert Amanda im «Basistarif» unbewusst Werbespots vor sich her. Weil das ihren Job als Grundschullehrerin gefährdet, muss die werbefreie Plus-Variante her. Die kostet allerdings 500 Dollar mehr – pro Monat.
Als sich die beiden kein Upgrade mehr leisten können, zieht ihnen Rivermind mit Booster-Angeboten das letzte Geld aus der Tasche. Über eine App können Amandas Empfindungen wie Lust oder Gelassenheit für wenige Stunden gesteigert werden.
Reine Science-Fiction, was Netflix uns hier auftischt – oder eine echte Zukunftsmöglichkeit?
Neurowissenschaftler: Mit heutiger Technologie unmöglich
Neurowissenschaftler Silvan Moorweg* stellt klar: «Einen grösseren Teil des Gehirns ganz zu ersetzen und eine Art Prothese mit anderen Hirnregionen zu verbinden ... das ist aus heutiger Sicht noch für lange Zeit Science-Fiction.»
Hierfür müssten gezielt Milliarden von Verbindungen zwischen verschiedenen Hirnarealen hergestellt werden.
«Heutzutage können wir mit Dutzenden, vielleicht Hunderten Elektroden in Hirngebiete hineinhorchen. Das müsste man mindestens um den Faktor 10'000 erweitern, um wirklich Kernstücke des Gehirns ersetzen zu können», erklärt Moorweg.
Auch das gezielte Einspielen von Signalen ins Gehirn ist derzeit nur sehr beschränkt möglich.
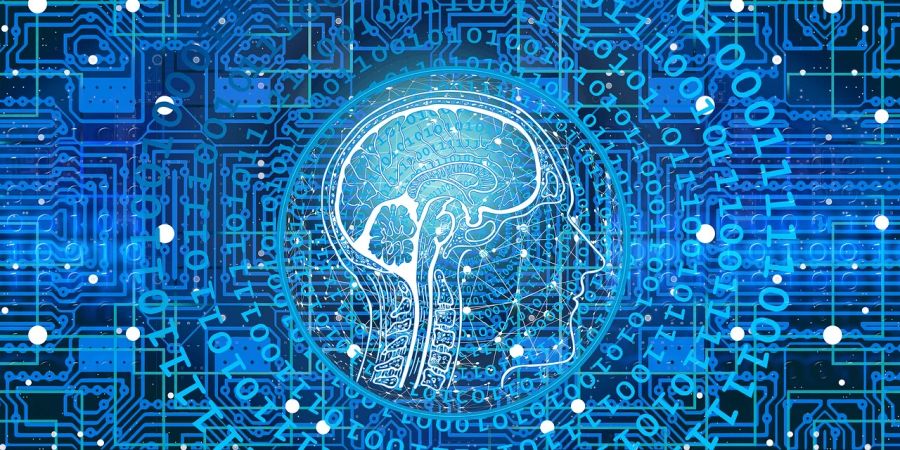
Dabei sind es gerade Phänomene wie Bewusstsein oder abstraktes Denken, die einen hohen Grad an Vernetzung erforderten, sagt der Hirnforscher. Mit heutiger Technologie? Unmöglich.
Trotzdem gibt es Technologien, die einen ersten Schritt in Richtung Hirn-Interface gemacht haben: Implantierte Elektroden erlauben es etwa, versuchte Hand- und Armbewegungen oder Sprache zu rekonstruieren.
Auch Tiefenhirnstimulation bei Parkinson-Patienten, Retina-Implantate für Sehbehinderte und Cochlea-Implantate bei Taubheit zeigen, was möglich ist.
Bei all diesen Verfahren spielt der Cloud-Aspekt zwar eine geringe Rolle. Eine Auslagerung von energieintensiven Berechnungen in eine Cloud sei jedoch «durchaus vorstellbar», so Moorweg.
Herzschrittmacher mit Abo-Modell?
Der Wissenschaftler erachtet Hirn-Maschine-Schnittstellen als grosse Chancen für Patienten, etwa um krankheitsbedingte Defizite auszugleichen.
Kritisch sieht er hingegen den Einsatz bei gesunden Menschen. Besonders problematisch wird es aus seiner Sicht, wenn Nutzer keinen vollständigen Zugriff und keine ständige Kontrolle über implantierte Systeme haben.
Moorweg warnt: «Der Kontrollverlust der Benutzer über etwas, das ein integraler Bestandteil ihrer selbst ist, ist ein sehr grosses Problem.»
Er sieht diese Entwicklung nicht nur als theoretisches Risiko: Bereits heute beobachte man bei vernetzten Medizingeräten wie implantierten Herzschrittmachern erste Anzeichen.
Diese könnten Daten nach aussen senden und würden zunehmend mit Zusatzangeboten verknüpft, etwa über Begleit-Apps für Ärzte und Patienten.
Von da ist es Moorweg zufolge kein grosser Schritt hin zu Abo-Modellen, wie sie bei Netflix gezeigt werden.
Folge 2: Der realitätsverändernde Quantencomputer
Das Leben von Lebensmittelforscherin Maria gerät aus der Bahn, als ihre ehemalige Klassenkameradin Verity in ihrer Firma angestellt wird.
Verity war damals eine computerbesessene Aussenseiterin und wurde von den anderen Schülerinnen gemobbt. Ihr Tiefpunkt erfolgte nach einem Gerücht, wonach sie einem Lehrer sexuelle Gefälligkeiten erwiesen habe. Das Gerücht hatte Maria verbreitet.
Bei der Arbeit häufen sich nun seltsame Erlebnisse, die Maria an ihrem Verstand zweifeln lassen.
Einmal trinkt Verity vor Marias Augen demonstrativ die Mandelmilch ihrer Kollegin. Diese hatte sich zuvor mehrmals beschwert, jemand bediene sich an ihrer Milch.
Später beschuldigt Verity Maria – und tatsächlich: Zu Marias grossem Schock zeigt eine Aufnahme der Überwachungskamera sie selbst beim Trinken der Milch. Nicht Verity.

Maria beteuert ihre Unschuld, indem sie auf ihre Nussallergie verweist. Doch niemand, nicht einmal Google, kennt diesen Begriff.
Als Maria Verity dann auch noch beschuldigt, mithilfe ihres Halsanhängers die Realität zu verändern, wird sie gefeuert.
Dabei liegt sie mit ihrem Verdacht (fast) richtig: Computer-Nerd Verity hat nämlich einen Quantencomputer gebaut, mit dem sie den Lauf der Dinge ändern kann. Der Anhänger dient als Fernbedienung.
Via Anhänger diktiert Verity dem Quantencomputer die gewünschte alternative Realität.
Dieser versetzt sie dann in ein Paralleluniversum, in dem alles, was sie jemals gesagt hat, wahr ist. Und in der Maria die einzige Person ist, die sich der Veränderungen in ihrer Realität bewusst ist.
Damit will sie Maria in den Wahnsinn treiben. Aus Rache, weil diese während der Schulzeit ihren Ruf zerstört hat.
Physiker: Quantencomputer wird «Wahrnehmungen nicht manipulieren können»
Dieses Szenario, das sich Netflix ausgedacht hat, ist reine Fiktion, sagt Quantenphysiker Renato Renner zu Nau.ch: «Ein Quantencomputer ist zwar eine sehr leistungsfähige Rechenmaschine, aber unsere Wahrnehmungen wird er nicht manipulieren können.»
Dazu bräuchte es theoretische und experimentelle Fortschritte, die «weit über die Herstellung von Quantencomputern hinausgehen».
Hingegen gibt es innerhalb der Quantenforschung durchaus Theorien, die von alternativen Realitäten oder Paralleluniversen ausgehen.
Zu den populärsten gehört die «Viele-Welten-Theorie». Sie besagt, dass es neben der Welt, die wir als «real» wahrnehmen, unzählige andere parallele Welten gibt. In diesen gibt es «Kopien» von uns, die diese parallelen Welten ihrerseits als Realität wahrnehmen.
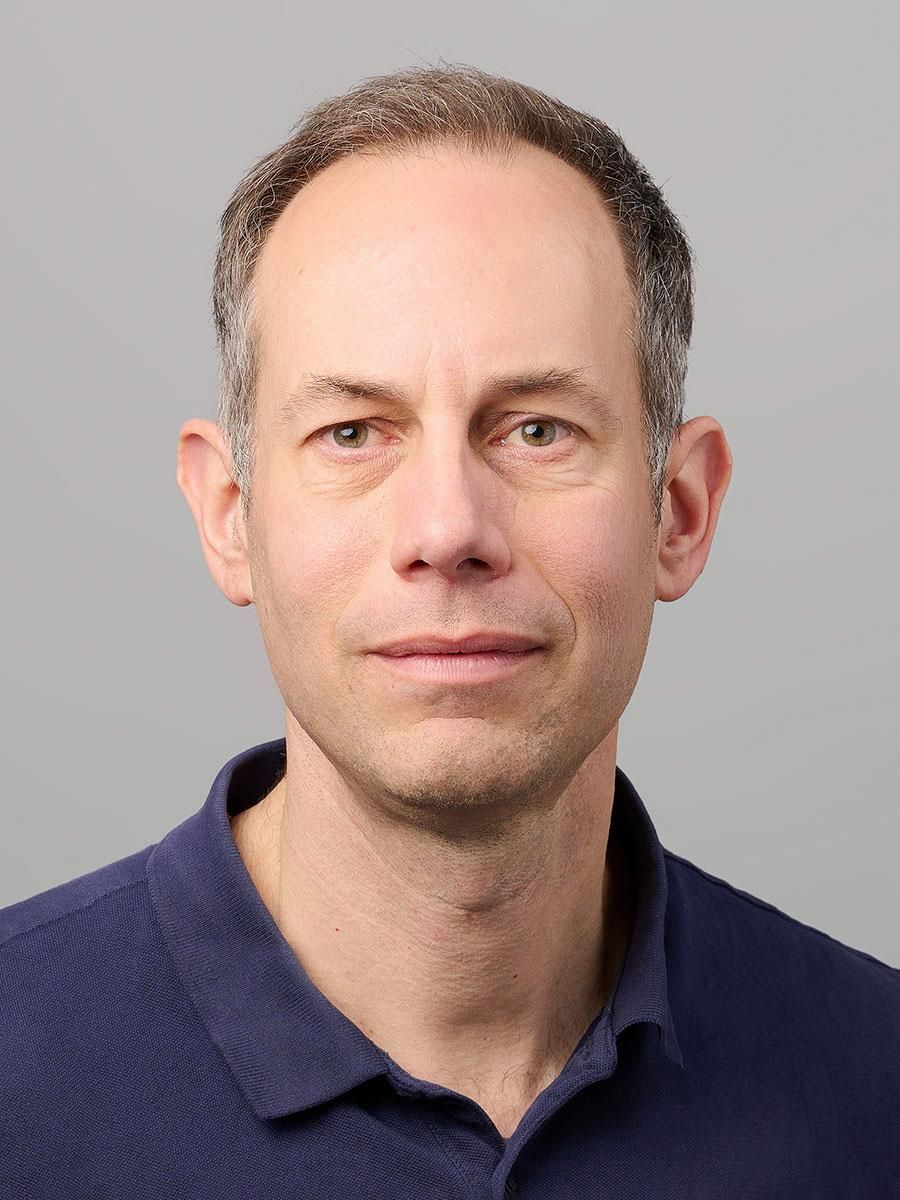
«Diese Interpretation ist jedoch umstritten und es gibt meiner Meinung nach auch gute Argumente, die dagegen sprechen», sagt Renner.
Selbst wenn die Viele-Welten-Interpretation korrekt sein sollte: Auch mithilfe von Quantencomputern wäre es nicht möglich, in eine parallele Welt zu springen, sagt der ETH-Forscher.
Genauso wenig realistisch sei, dass jemand einen Quantencomputer ausserhalb eines Forschungslabors bauen könne. «Das Problem bestände wohl vor allem darin, die nötige Expertise zusammenzubringen», so Renner.
Ein Quantencomputer könne nur von einem hochspezialisierten Team gebaut werden, deren Mitglieder sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren. «Für eine Einzelperson scheint mir dies nicht machbar.»
Folge 5: Eintauchen in alte Fotos als Virtual-Reality-Therapie
Einen versöhnlicheren und weniger Technologie-skeptischen Ton als die ersten beiden Episoden schlägt Netflix in der fünften Folge an: «Eulogy».
Das gleichnamige Bestattungsunternehmen informiert Philipp, einen zurückgezogen lebenden Amerikaner, über den Tod seiner englischen Ex-Freundin Carol.
Ihre Beziehung ist zwar Jahrzehnte her, doch von der Trennung hat sich der verbitterte Philipp nie richtig erholt.

Eulogy bittet Philipp, einen Beitrag in Form von Erinnerungen an eine Virtual-Reality-Gedenkfeier beizusteuern. Nach anfänglichem Zögern willigt er ein.
Er erhält ein Set, das nicht viel mehr als einen Chip enthält, den er an seiner Schläfe befestigen muss. Die Technologie ermöglicht es Philipp, buchstäblich alte Fotos zu betreten und sich in den dargestellten Situationen zu bewegen.
In Begleitung eines virtuellen Guides arbeitet er seine gescheiterte Beziehung Bild für Bild auf.
Virtual-Reality-Forscher: Einzelnes Foto wie bei Netflix reicht nicht
Oliver Christ ist Ingenieurpsychologe und Virtual-Reality (VR)-Forscher im Digital Innovation Lab der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Seine erste Reaktion zum Szenario bei Netflix: «Nicht realistisch – aber wer weiss, was die zukünftige technische Entwicklung noch alles bringt.»
Tatsächlich gibt es bereits Technologien, mit denen sich reale Orte digital nachbauen lassen. Beispielsweise durch Laserscanner, Fotogrammetrie oder sogenannte digitale Zwillinge, wie sie in der Architektur oder Denkmalpflege zum Einsatz kommen.

Damit lassen sich Baufortschritte in 3D erfassen oder historische Gebäude wie das ETH-Chemielabor aus dem Jahr 1900 virtuell wiederbegehbar machen.
Doch all das basiert auf vielen Bildern oder präzisen Bauplänen. Ein einzelnes Foto reiche nicht aus, um eine komplexe Szene realistisch zu rekonstruieren, erklärt Christ.
Noch ist solche Technik aufwendigen Set-ups vorbehalten. Bis sie in einem kleinen Chip oder einem Smartphone verbaut werden kann, ist es laut Christ noch ein weiter Weg: «Angefangen bei der Materialforschung bis hin zur Leistungsfähigkeit der Sensoren.»
Virtual Reality birgt ethische Risiken
Und dann wäre da noch die Frage: Welche rechtlichen Probleme treten auf, wenn plötzlich jeder mit einem Knopfdruck seine komplette Umwelt in einen digitalen Zwilling verwandeln kann?
Trotz aller Hürden sieht Christ grosse Chancen in solchen immersiven VR-Erlebnissen – vor allem im Training oder in der Therapie. «VR ermöglicht sichere Trainingsbedingungen, mit dem Einbezug von mindestens drei Sinnen und verschiedenen Perspektiven», erklärt er.
So liessen sich nicht nur reale Orte besuchen, sondern auch komplett unmögliche. Etwa das Innere eines Triebwerks während der Zündung oder eine Zeitreise in die Antike. Erste Studien zeigen auch den erfolgreichen Einsatz bei ADHS oder posttraumatischer Belastungsstörung.
Ganz ohne Risiken ist das nicht. Christ nennt zwei konkrete Beispiele: «Simulation- oder Motion-Sickness» – also Übelkeit oder Kopfschmerzen, wenn das Gehirn mit der Sinneswahrnehmung nicht klarkommt.
Und: Ethische Risiken bei Kindern. Studien zeigen, dass Kinder sich in VR zwar gut Inhalte merken – gleichzeitig aber anfälliger für falsche Erinnerungen sind.
Christs Empfehlung: «Man sollte bei Kindern gut aussuchen, wer schon in VR lernen kann und möglichst lange einen ganzheitlichen analogen Lernvorgang einsetzen.»
*Der Neurowissenschaftler heisst in Wirklichkeit anders. Er möchte nicht namentlich erwähnt werden.



















