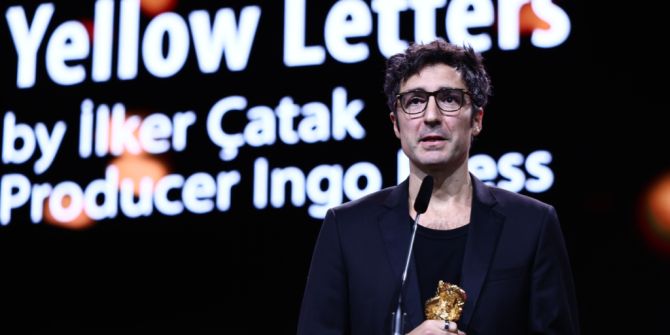Die Nächte werden länger - das Faszinosum Dunkelheit
«Verdrängt, gezähmt, durchleuchtet»: Die Nacht hat mittlerweile viel von ihrem einstigen Schrecken verloren. Für Nachteulen sowieso. Doch das Zwielichtige hängt ihr weiterhin an.

Das Wichtigste in Kürze
- Nachtschwärmer, die dem Sonnenlicht entfliehen, gibt es schon im alten Rom.
Jene «Lucifugae» erobern damals die dunklen Stunden für sich.
Seneca etwa berichtet von einem Mann, der sich um neun Uhr abends seinen Abrechnungen widme, um Mitternacht Sprechübungen veranstalte und um zwei in der Früh zur Spazierfahrt aufbreche. Im Morgengrauen erst gibt es die Hauptmahlzeit. Er habe «nichts als die Nacht zu sich genommen», schreibt der Philosoph. Und die war in der Antike, wenn kein Mond am Himmel stand, richtig duster.
Auch heutige Geniesser der Dunkelheit sehen den kommenden Monaten sehnsuchtsvoll entgegen, denn wegen der Uhrumstellung verabschiedet sich der helle Tag dann noch früher am Abend. Zudem werden die Nächte länger, weil die Sonne Richtung südlicher Wendekreis wandert.
Doch um sich heutzutage mit besonders ausgeprägter Dunkelheit umgeben zu können, muss man lange suchen. In den Städten, in denen die Nächte künstlich immer heller werden, ist das wegen der Lichtverschmutzung seit Jahren gar nicht mehr möglich. Nach Angaben der International Dark-Sky Association lassen sich die dunkelsten Orte Deutschlands unter anderem im Nationalpark Eifel oder auf der Winklmoosalm an Bayerns Grenze zu Österreich finden. Das Dorf Gülpe in Westen Brandenburgs ist ein wahres Ruhe-Mekka für nächtliche Sternengucker geworden.
In Grossstädten hingegen herrscht mittlerweile im Dunkeln ähnlich viel Betriebsamkeit wie am Tag. «Die Nacht kann heute vielfach gar nicht mehr wahrgenommen werden als das, was sie einmal war», sagt Bernd Brunner, der in seinem jüngst erschienenen «Buch der Nacht» die Stunden zwischen Dämmerung und Morgengrauen unter die Lupe nimmt.
Gerade die Erfindung der elektrischen Beleuchtung Ende des 19. Jahrhunderts habe «alles grundlegend verändert», so der Autor im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Nacht sei die Dramatik von früher abhanden gekommen. «Heute ist sie verdrängt, gezähmt, durchleuchtet.» Mit dem künstlichen Licht strecken sich die Aktivitäten bis spät in den Abend und verdrängen den Schlaf.
«In unserem kulturellen Bewusstsein ist die Nacht geprägt als eine Zeit der Grenzüberschreitung, des Verbrechens und der gefährlichen Gestalten», sagt Brunner. Vor marodierenden Gruppen sei auch schon im geschäftigen Nachtleben der Antike gewarnt worden. Seit jeher ist die Dunkelheit eine verrufene Zeit. Nicht umsonst warnt die deutsche Polizei jährlich anlässlich der herbstlichen Uhrenumstellung unter anderem vor den Gefahren von Einbrechern.
Spektakuläre Aktionen wie der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden oder der Diebstahl einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum wurden im Schutz der Dunkelheit begangen. Doch in Wohnungen wird in der Regel nicht des Nachts eingestiegen - sondern eher tagsüber, wie eine Analyse der deutschen Versicherungswirtschaft 2015 ermittelte.
Wie die Nacht wahrgenommen wird, ist aber individuell verschieden. Bei seiner Befragung über die empfundene (Un-)Sicherheit fand das Bundeskriminalamt 2017 heraus, dass sich zwar rund vier von fünf Menschen in Deutschland nachts in ihrer Wohngegend sehr oder eher sicher fühlen. Dennoch vermeiden demnach vor allem Frauen, bei Dunkelheit alleine draussen unterwegs zu sein.
Doch sind diese Stunden auch die Zeit der Ausschweifungen und des Tanzes. Heutige Clubs haben wohl ihren Ursprung in Paris. 1881 öffnet auf dem Montmartre das Kabarett «Le Chat Noir» für die damalige Bohème. Dort erlaubt die Polizei erstmals auf der Bühne ein Klavier, an das sich Künstler wie Erik Satie und Claude Debussy setzen. Bald machen in vielen Metropolen Amüsierfreudige die Nacht zum Tag. In Berlin putzt sich zum Beispiel der Admiralspalast an der Friedrichstrasse als neues, weltstädtisches Etablissement heraus.
Die Menschen «wollen sich ausprobieren», schreibt Brunner in seinem «Buch der Nacht», «suchen einen Ort, eine Gegenwelt, in der sie sich fallen lassen oder vergessen können, wo das Prinzip, "normal" funktionieren zu müssen, aufgehoben ist».
Nur jüngst kam das Nachtleben in der Corona-Pandemie zum Erliegen. Mit dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen mussten Bars und Kneipen schliessen. Plötzlich verhängten auch Städte, die eigentlich nie schliefen, Ausgangsschranken und Sperrstunden. Clubs, die sonst teils über mehrer Tage und Nächte hinweg Tanzwütigen eine Flucht aus dem Alltag boten, lagen brach. Ein dramatischer Einschnitt.
Doch manche werden im vergangenen Winter bemerkt haben: Auf Spaziergängen oder Joggingrunden allein wird Dunkelheit ganz neu wahrgenommen. Wer bis dahin die Abendstunden für das Beisammensein mit Freunden reserviert hatte, ist auf einmal mit jemand anderem konfrontiert: «Die Nacht zwingt eher dazu, sich Gedanken über sich selbst zu machen», sagt Brunner. Angenehme wie unangenehme.
Eine wahre Nachteule soll Johann Wolfgang von Goethe gewesen sein. Er arbeitete bei Kerzenschein und ging in der Dunkelheit schwimmen. «Ist die Nacht das halbe Leben, und die schönste Hälfte zwar», lässt er seine Philine in «Wilhelm Meisters Lehrjahre» singen.
Wie man die Finsternis erfährt und nutzt, ist von Mensch zu Mensch verschieden, von Kultur zu Kultur. Doch auch diejenigen, die den dunkleren Monaten nicht viel abgewinnen können, haben immerhin einen Lichtblick: Irgendwann wird es auch wieder heller.
Bernd Brunner: «Das Buch der Nacht», Galiani, 192 S., 28,00 Euro, ISBN 978-3-86971-230-7