Was bleibt nach der grossen Flut: zwei Romane über ein Thema
Zwei Romane beleuchten den schnellen Klimawandel auf sensiblen Insel-Ökosystemen: «Chimäre» von Sarah Kuratle und «Die letzt Insel» von Gabrielle Alioth.
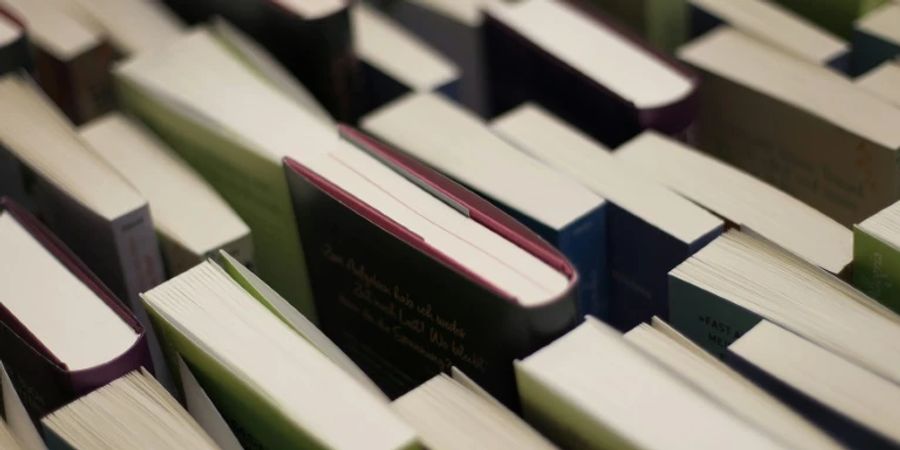
Inseln sind besonders sensible Ökosysteme. Aussterbende Arten finden dort eine Nische zum Überleben, doch der Klimawandel macht sich hier schneller bemerkbar. Zwei stilistisch ungleiche Romane, die nahezu zeitgleich erschienen sind, beleuchten solche Entwicklungen: «Chimäre» von Sarah Kuratle und «Die letzte Insel» von Gabrielle Alioth.
In Psalm 124 heisst es: «so ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsere Seele». Diese Passage schreibt die Autorin Sarah Kuratle in ihrem Roman «Chimäre» weiter: «Dörfer gingen unter ... mit ihnen Menschen». Die Welt ist aus den Fugen geraten, die Insel, auf der ein gewisser Gregor lebt, scheint dem Untergang geweiht. Dennoch pflegt er Pflanzen und sucht für das letzte «Café Marron-Kraut» einen Ort, wo es überleben kann.
Gregor sei ein Mischwesen, eine «Chimäre aus Fisch und Vogel», sagt seine Freundin Alice. Während für ihn die Insel ein Zuhause ist, ahnt sie, dass es jenseits dieser Insel mehr gibt. «Es zieht mich weg.» Sie folgt ihrem Gespür in eine andere Freiheit. Vielleicht aber gibt es diese Freiheit doch nur auf der Insel.
Aus den beiden Perspektiven entwirft Sarah Kuratle eine Welt, die zwischen Gedeihen und Verlust schwankt. Alice geht weg, dafür besucht eine junge Frau die Insel. Tera ist eine «Ortlose», Kind von «minderwertigen» Eltern, die weder eine Muttersprache noch eine Identität haben durften. Sie und Gregor fühlen einander zugehörig, denn auch Gregor kennt Missbrauch und sprachlose Geheimnisse.
Kuratles «Chimäre» zwischen Andeutung und Atmosphäre
Ihre Figuren umgarnt Kuratle mit einer poetischen Sprache, sie verspinnt sie in ein atmosphärisch dichtes Textgewebe, das mehr andeutet, als klarstellt. Der Ton in «Chimäre» ist leise und schwebend. Als Alice einen Apfel pflücken will, «verheddert sie sich in einem Netz, bis zur Unkenntlichkeit fein. Sie reisst an den Fäden, zerreisst sie».
Mit diesem filigranen Netz umhüllt Kuratle Motive und Bilder, die von Naturzerstörung, Artensterben, sozialer Spaltung erzählen, aber auch vom sanften Widerstand gegen die Verluste, wenn Gregor Samen hütet oder Alice auf ihren Reisen Stimmungen und Aussichten sammelt. Dabei geht es der Autorin auch ums Schreiben selbst, denn «erzählende Bilder zeigen nicht, wie etwas ist. Sondern wie es erlebt worden, am Leben war». Sie sucht eine Form, die erzählt und zugleich festzuhalten versucht, was sich der Sprache entzieht. In diesem Sinn ist «Chimäre» ein luftiges, chimärisches Buch zwischen Erzählung und Poesie.
Wo Kuratle nach und nach Grenzen und Trennungen aufhebt, erzählt Gabrielle Alioth in ihrem Roman «Die letzte Insel» auf zwei getrennten, doch miteinander kommunizierenden Ebenen. Alioths Ich-Erzählerin ist Autorin; sie hat durch eine Flut auf der Insel ihren Mann verloren. Er wurde von den Wassermassen weggespült und nie mehr gefunden. In ihrem neuen Haus lebt sie allein mit einem Hund, telefonisch hält sie Kontakt mit ihrem Geliebten, der fernab von ihr eine eigene Familie hat.
Diese Konstellation arbeitet die Ich-Erzählerin in eine eigene Geschichte ein. Diese weitere literarische Erzählung ist die zweite Ebene. Sie handelt vom «Inselbiogeographen» namens Holm in einer fernen Zukunft, der die Restbestände von Flora und Fauna inventarisiert. Er ist ein Spezialist für Inseln, die dem Untergang geweiht sind, sei es wegen Überflutung oder weil das Militär sie mit chemischen und atomaren Abfällen vermüllt hat. Die Welt erscheint feindlich und düster. Die Berge erodieren, die Fluten steigen, Holms Protokolle würden lediglich in einem Jahresbericht seines Instituts erwähnt werden.
Alioths Roman über Holm und das geheimnisvolle Inselparadies
Mit Geschichte über Holm lebt die Ich-Erzählerin ihre Fantasien und Ängste ebenso wie ihre Schuldgefühle gegenüber dem verschollenen Gefährten aus. Zuletzt strandet Holm auf einem rätselhaften, steinigen Eiland, das von 13 Mönchen bewohnt wird. Die Schweizer Autorin Alioth, die in Irland lebt, mag sich hier Skellig Michael zur Vorlage genommen haben, eine Felseninsel, der rund 14 Kilometer vor der irischen Küste von Kerry im Atlantik liegt. Im Frühmittelalter haben hier tatsächlich Mönche gelebt. Im Roman verschwimmt Skellig Michael mit dem mystischen Thule, vielleicht mit der Insel der Kalypso, zu einem verlorenen Restparadies, von dem es keinen Weg zurück gibt.
Die Ich-Erzählerin aus «Die letzte Insel» beschreibt Holms Welt akkurat und anschaulich. Raffiniert spiegelt sie darin Motive aus dem eigenen Leben, verfremdet sie und erweitert ihren Bedeutungsrahmen mit Verweisen auf die Evolutionsbiologie oder die Kunst von Carpaccio und Böcklin. Schliesslich bringt sie auch das Motiv der Chimären ins Spiel, die dereinst «aus Pilzen, Pflanzen, Tieren» entstehen werden. Wer schreibt, macht die Wirklichkeit erst kenntlich, weiss sie.
Holms Inventar der Verluste im einen, Gregors Pflege der aussterbenden Pflanzen im anderen Buch sind das einzige, was (uns) noch bleibt. Ein letzter Effort des Widerstands gegen eine sich aufheizende Welt. Sarah Kuratle und Gabrielle Alioth erzählen es auf je eigene Weise: eindrücklich und anregend.*
*Dieser Text von Beat Mazenauer, Keystone-SDA, wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.






