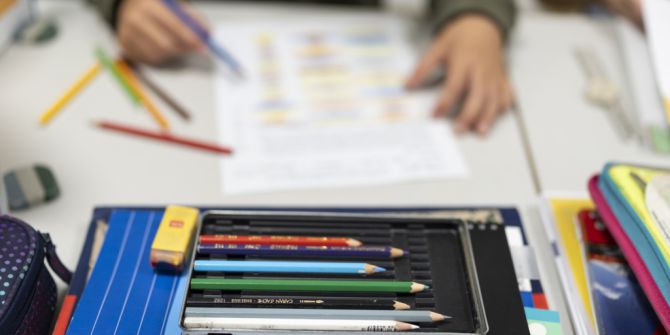PFAS und Mikroplastik: Kein Schweizer Ort ist davon verschont
Mikroplastik und Chemikalien breiten sich rasant aus: Selbst abgelegene Orte wie der Seealpsee oder das Matterhorn sind nicht mehr sicher. Ist das unaufhaltsam?

Das Wichtigste in Kürze
- Mikroplastik und Chemikalien belasten Schweizer Orte.
- PFAS und Mikroplastik verbreiten sich in der Natur.
- Experten bestätigen: Kein Ort ist mehr unbelastet.
Der Seealpsee im Kanton Appenzell Innerrhoden ist ein regelrechtes Juwel. Die Natur wirkt hier unberührt – doch der Schein trügt.
In Proben konnten kürzlich Mikroplastik und Chemikalien aus Reifen nachgewiesen werden. Diese Substanzen können vor allem für Kleinlebewesen wie Krebstierchen im See schädlich sein.
Auch das vermeintlich unberührte Matterhorn bleibt von Chemikalien nicht verschont. Forschende wiesen dort kürzlich die sogenannten Ewigkeitschemikalie PFAS nach.
Die Wunderwaffe findet sich in Jacken, Rucksäcken, Bratpfannen, Skis oder Pestiziden – und baut sich nur schwer ab. Beim Abbau entsteht TFA, ein Stoff, der praktisch nicht mehr zerfällt und sich in Wasser und Körpern anreichern kann.
Müssen wir also davon ausgehen, dass an jedem noch so abgelegenen Ort Chemikalien, Pestizide und Mikroplastik liegen?
Nau.ch hat bei zwei Umweltexperten nachgefragt. Die Antwort lautet klar: «Ja».
Andri Bryner, Hydrologe und Medienverantwortlicher am Wasserforschungsinstitut Eawag, erklärt: «Zahlreiche Stoffe sind – wenn sie einmal in der Umwelt sind – sehr mobil.» Wind und Regen verteilen sie überallhin.
Schweizer Grundwasser ist flächendeckend belastet
«Genau betrachtet gibt es keine Orte mehr, die komplett unbelastet sind», sagt er. Die Konzentrationen schwanken allerdings stark.
Bryner: «Die Flächen, auf denen wirklich problematische Konzentrationen gemessen werden, sind zum Glück noch begrenzt. Zum Beispiel bei Abfalldeponien oder Feuerwehrübungsplätzen.»
Doch: «Die ‹Ewigkeitschemikalie› TFA allerdings kommt schon fast flächendeckend im Grundwasser vor, namentlich im Mittelland.»
Auch Alexandra Kroll, Mikroplastik- und PFAS-Spezialistin beim Schweizerischen Zentrum für angewandte Ökotoxikologie, bestätigt: «In Bezug auf PFAS und Mikroplastik gibt es vermutlich keine unversehrten Orte mehr.»
Allerdings gibt es in der Schweiz noch Gewässer, in denen PFAS unter der Nachweisgrenze liegen.
15'000 Tonnen Reifenabrieb pro Jahr landen in der Umwelt
«Auch bei Mikroplastik muss man aufgrund der Verteilung über Niederschläge und Wasser davon ausgehen, dass es praktisch überall vorkommt.»
Die Quellen sind vielfältig: Farben, Reinigungsmittel, Kosmetik oder Unfälle mit Containerschiffen. Mikroplastik entsteht aber auch durch die Zersetzung von Plastikmüll, Abrieb oder das Waschen synthetischer Kleidung.

Auch der Verkehr spielt eine Rolle: In der Schweiz gelangen jährlich zwischen 10'000 und 15'000 Tonnen Reifenabrieb in die Umwelt.
Die Konzentration von Chemikalien und Mikroplastik dürfte weiter steigen.
«Wichtig bei PFAS und Mikroplastik ist grundsätzlich die Anreicherung und sehr langsamer bis nicht bekannter Abbau», erklärt Kroll. «Weiterhin haben PFAS wie Mikroplastik langfristige/chronische Effekte, nicht akute wie zum Beispiel akute Vergiftung oder Tod.»
Belastete Böden müssen aufwändig saniert werden
Hydrologe Andri Bryner ergänzt: «Im Fall von belasteten Böden sind Sanierungen nötig. Das ist sehr aufwändig und teuer. Je nach Ausmass der Belastung muss der Boden lokal sogar abgetragen und verbrannt werden.»
Bei grösseren Flächen sei eine Sanierung oft unmöglich. «Da bleibt im Extremfall fast nur die Aufgabe der Bewirtschaftung», sagt er.
Heisst also: Landwirtschaftliche Flächen müssten dann etwa umgenutzt werden.
Belastetes Wasser kann als Trinkwasser zwar aufbereitet werden. «Doch auch das ist sehr aufwändig und benötigt viel Energie. Kleine, lokale Wasserversorger werden das kaum stemmen können», so der Hydrologe.

Für die Tierwelt ist die Belastung durch Pestizide, Chemikalien und Plastik fatal.
Bryner: «Von gewissen Pestiziden messen wir Konzentrationen in den Bächen, die für Gewässerorganismen klar ein Risiko darstellen.»
Noch wisse man wenig über die Kombination der verschiedenen Stoffe. Dazu komme die zunehmende Erwärmung der Gewässer.
«Im Endeffekt bedeutet das, dass heute schon seltene, sensible Arten verschwinden und nur noch die unempfindlichen ‹Allerweltsarten› übrig bleiben.»
Bei PFAS sind die Auswirkungen auf Tiere noch wenig untersucht. Erste Erkenntnisse zeigen aber: PFAS können sich in der Nahrungskette anreichern und Einfluss auf Wachstum, Fortpflanzung und das Immunsystem von Tieren haben.
Alle Menschen haben wohl PFAS im Blut
Auch beim Menschen hinterlassen PFAS Spuren. Spezialistin Alexandra Kroll weist darauf hin: «Basierend auf einer Pilotstudie des BAG wurden in allen Blutproben von knapp 800 Probanden die gemessenen PFAS gefunden.»
Die meisten Konzentrationen gelten derzeit als unbedenklich – Folgeuntersuchungen fehlen aber.

Auch Mikroplastik wurde wiederholt in menschlichem Stuhl nachgewiesen. «Kleinere Partikel können vereinzelt in Blut- und Gewebeproben nachgewiesen werden», sagt sie.
Wie gefährlich das ist, bleibt unklar und bedarf weiterer Forschung. «In Tiermodellen hat man vor allem Entzündungsreaktionen beobachten können.»
Beim Menschen liegen die Mikroplastik-Konzentrationen allerdings weit unter jenen, bei denen Tierversuche Effekte zeigten.
Expertin: «Stecken in Teufelskreis»
Bleibt die Frage: Was kann man tun, damit abgelegene Orte wie der Seealpsee oder das Matterhorn nicht weiter belastet werden?
«In beiden Bereichen (PFAS, Mikroplastik) stecken wir in einem Generationenprojekt und aktuell in einem ‹Teufelskreis›. Viele Bereiche des alltäglichen Lebens beruhen auf dem Einsatz dieser Materialien», erklärt Kroll.
PFAS-Emissionen könnten durch Beschränkungen, Abgaben und bessere Information reduziert werden. Technische oder biologische Methoden könnten PFAS aus Böden, Wasser und Abfall entfernen – oft jedoch aufwändig und teuer.
Und beim Plastik?
Hydrologe Andri Bryner vom Eawag rät: «Möglichst wenig Plastik verwenden, Plastik korrekt entsorgen, gehört dazu.»
Mikroplastik-Spezialistin Alexandra Kroll ergänzt: Plastik- und Mikroplastik-Einsatz sollte auf Notwendigkeit und langfristige Folgen geprüft – und notfalls verboten werden.