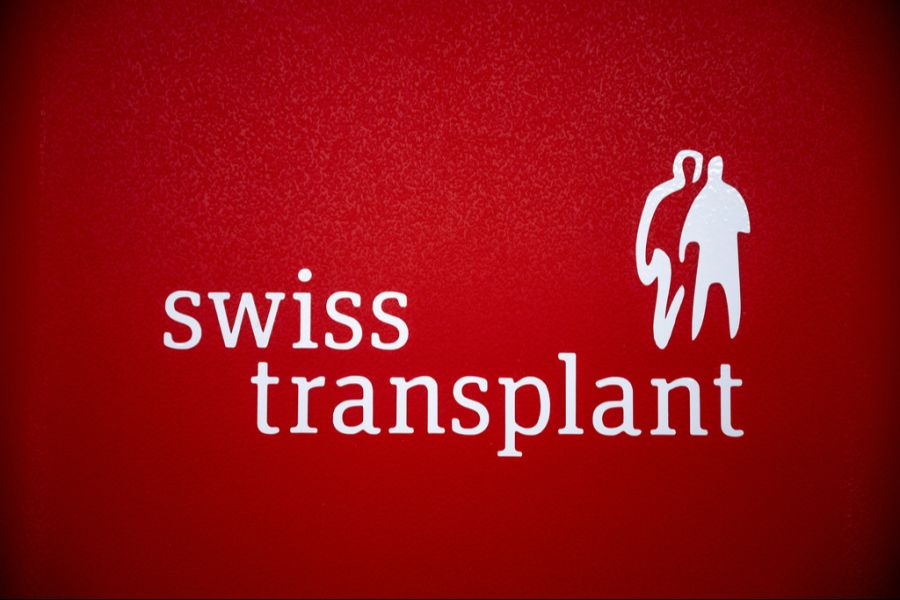Menschen sterben auf Warteliste – Spenderlebern werden exportiert
Während in der Schweiz Menschen auf der Warteliste stehen, werden Spenderorgane von Schweizer Ärzten abgelehnt und ins Ausland geschickt.

Das Wichtigste in Kürze
- In der Schweiz standen letztes Jahr 491 Menschen auf der Warteliste für eine Spenderleber.
- 2024 starben 36 Personen im Warten auf eine geeignete Spende.
- Weil Schweizer Ärzte mögliche Spendenorgane ablehnten, wurden diese ins Ausland geschickt.
- «Wir haben hier tatsächlich ein Problem», sagt Swisstransplant-Direktor Franz Immer.
491 Menschen warteten letztes Jahr in der Schweiz auf eine lebensrettende Lebertransplantation. Doch nur 133 von ihnen erhielten das kostbare Organ.
Währenddessen starben 36 Menschen auf der Warteliste – und potenziell geeignete Spenderlebern wurden nicht genutzt.
Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» ergaben, wurden in den letzten zwei Jahren 20 Schweizer Lebern ins Ausland exportiert. Dies, obwohl es hierzulande passende Empfänger gegeben hätte.
«Wir haben hier tatsächlich ein Problem»
Diese Organe wurden von schweizerischen Ärzten abgelehnt, manchmal ohne sie überhaupt persönlich begutachtet zu haben. Ärzte im Ausland befanden die Lebern für tauglich und setzten sie ihren Patienten ein.
Damit wurde fast jede zehnte Schweizer Leber nicht in der Schweiz transplantiert.
Franz Immer ist seit 17 Jahren Direktor von Swisstransplant und verantwortlich für die Koordination von Organspende und Transplantation. Er gibt gegenüber der «NZZ am Sonntag» offen zu: «Wir haben hier tatsächlich ein Problem.»
«Die Organverwendungsquote ist in den letzten zwei Jahren markant gesunken.» Die Schweiz sei einst zusammen mit Italien europaweit führend in dieser Quote gewesen. Heute liege sie unter dem Durchschnitt.
Das bedeutet konkret: Die Krankenhäuser transplantieren weniger der zur Verfügung stehenden Spenderlebern.
Die Folgen sind gravierend
Immer zufolge seien schweizerische Zentren bei Spenderlebern, die nicht optimal erscheinen, vorsichtiger geworden. Dies betreffe insbesondere Lebern, die nach Herz-Kreislauf-Stillstand entnommen wurden und bei denen es zu schlechten Ergebnissen kam.
Aber auch bei den anderen Lebern ist die Verwendungsrate gesunken – der Grund dafür bleibt unklar.
Die Konsequenzen sind gravierend: Geeignete Organe könnten einfach durch das Raster fallen und nicht genutzt werden.
Franz Immer weist darauf hin, dass Zeit- und Kostendruck ebenfalls eine Rolle spielen. Entnahme und Bewertung von Organen erfordern viele Ressourcen. Dies wird nur dann vollständig von der Krankenkasse bezahlt, wenn das Organ tatsächlich transplantiert wird.
«Was in der Schweiz passiert, ist sehr besorgniserregend»
Auch international wird diese Praxis kritisch beäugt. Peter Lodge, Präsident der European Surgical Association und einer der renommiertesten Leberchirurgen weltweit, sagt: «Was in der Schweiz passiert, ist sehr besorgniserregend.»
Er fügt hinzu: «Solange inländische Patienten auf der Warteliste sterben, sollten keine Organe ins Ausland gehen.»
Franz Immer sieht die Lösung im medizinischen Fortschritt. Er arbeitet daran, eine neue Entnahmetechnik schweizweit einzuführen, um so die Verwendungsrate zu erhöhen.
«Wir versuchen momentan, dafür die Finanzierung sicherzustellen», sagt Immer.