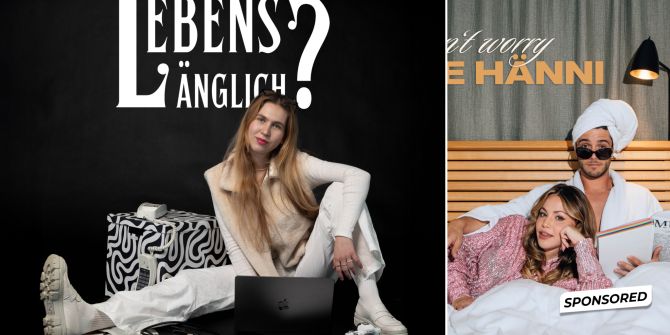Mehr Unterstützung: Zahl an Sonderschulklassen wächst schweizweit an
In der Schweiz gibt es immer mehr Sonderschulklassen. Das liegt daran, dass die integrative Schule hierzulande stark unter Druck steht.

Das Wichtigste in Kürze
- Immer mehr Kinder in der Schweiz besuchen eine Sonderschule.
- Oft geschieht das nicht wegen klarer Defizite, sondern um zusätzliche Mittel zu erhalten.
- Fachleute warnen vor negativen Folgen für die Kinder.
Immer mehr Kinder in der Schweiz besuchen eine Sonderschule, weil die integrative Schule an ihre Grenzen stösst. Im Kanton Bern wurden im letzten Schuljahr 50 neue Sonderschulklassen eröffnet.
Auch andere Kantone melden einen deutlichen Anstieg. Diese Entwicklung stellt das Prinzip «Eine Schule für alle» zunehmend infrage.
Immer häufiger erhalten Kinder einen Sonderschulstatus
Die Idee der integrativen Schule ist es, Kinder mit besonderem Förderbedarf im Regelunterricht ihres Wohnorts zu unterrichten. Dabei sollen sie zusätzliche Unterstützung von Fachpersonen wie Heilpädagoginnen und Logopäden erhalten.
Ziel ist es, Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe zu ermöglichen, ohne auf getrennte Strukturen zurückzugreifen. Dieses Modell orientiert sich laut der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik an der UNO-Behindertenrechtskonvention.
In der Praxis jedoch zeigt sich ein anderes Bild. Immer häufiger erhalten Kinder einen Sonderschulstatus. Dies nicht unbedingt wegen klar diagnostizierter Defizite, sondern um zusätzliche Mittel zu sichern.
Sonderschulstatus kann spätere Laufbahn negativ beeinflussen
Myriam Ziegler vom Zürcher Volksschulamt erklärt gegenüber dem SRF: «Wenn die Ressourcen fehlen, wird Kindern ein Sonderschulstatus zugesprochen, damit sie überhaupt die nötige Unterstützung erhalten.» Das passiere, auch wenn sie formal nicht darauf angewiesen wären.
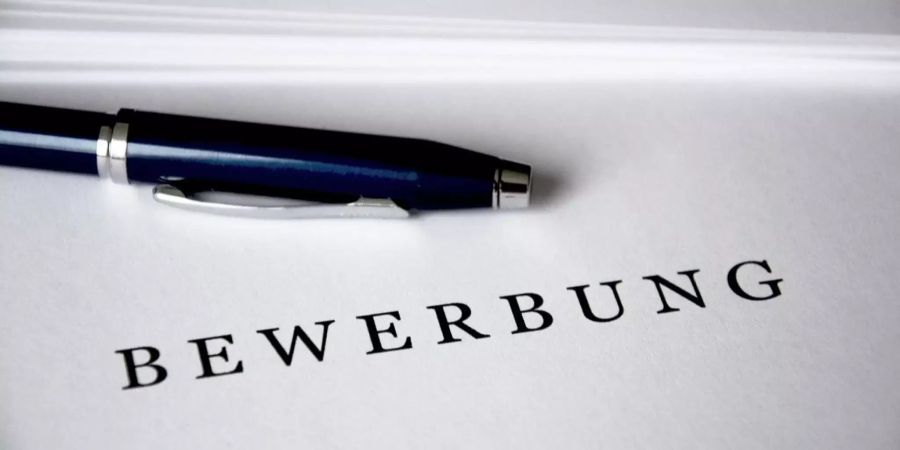
Dieser Mechanismus hat Folgen. Einerseits ermöglicht der Status mehr schulische Betreuung und angepasste Lernziele. Andererseits trägt er ein Stigma mit sich.
«Ein Kind, das eigentlich nicht sonderbeschult werden müsste, wird unnötig gelabelt», warnt Ziegler. Das könne sich negativ auf Zeugnisse und spätere Laufbahnen auswirken.