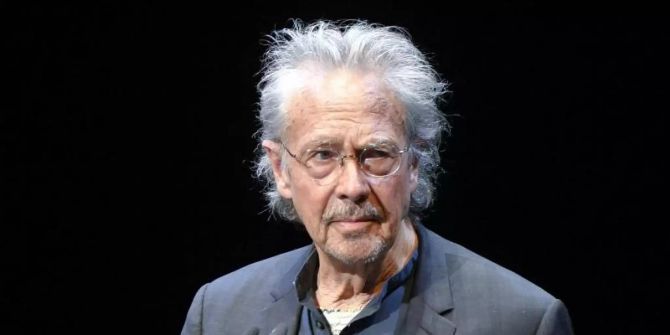Srebrenica: Erinnerung und Kampf gegen das Vergessen
30 Jahre nach dem Genozid von Srebrenica sind die Wunden offen, die Aufarbeitung stockt und die Leugnung des Massakers bleibt eine Belastung für die Region.

Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Einheiten in Srebrenica mehr als 8000 Bosniaken. Das Massaker gilt als das schwerste Kriegsverbrechen Europas seit 1945, wie «ZDF heute» berichtet.
Die Opfer waren fast ausschliesslich Männer und Jungen muslimischen Glaubens, so das Magazin «alexandria».
Die Stadt war damals von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden. Dennoch konnten die UN-Blauhelme die Zivilisten nicht schützen, wie «Deutschlandfunk» meldet.
Internationale Anerkennung als Genozid
Die Täter gingen systematisch vor, trennten Männer von ihren Familien und exekutierten sie an verschiedenen Orten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Gerichtshof erkannten das Massaker als Genozid an.

Die Verurteilung von Ratko Mladic und Radovan Karadzic zu lebenslangen Haftstrafen war ein Meilenstein der internationalen Justiz.
Noch immer sind fast 1000 Menschen vermisst. Ihre Familien warten auf Antworten und Gerechtigkeit, wie «Amnesty International» berichtet.
Die offene Wunde Srebrenica
Viele Angehörige kämpfen bis heute um die Identifikation der Opfer und ein würdiges Gedenken. Die UN-Generalversammlung hat 2024 den 11. Juli zum Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica erklärt.

Der Widerstand aus Serbien und Teilen der bosnisch-serbischen Bevölkerung ist jedoch gross, wie die «Zeit» berichtet.
In der Republika Srpska, dem serbisch dominierten Landesteil Bosniens, wird der Genozid vielfach geleugnet.
Leugnung und fehlende Aufarbeitung
Präsident Milorad Dodik bestreitet öffentlich, dass es sich um einen Völkermord gehandelt habe. Laut bosnischem Recht ist diese Leugnung strafbar, so die «Zeit».
Die Leugnung des Genozids bleibt ein zentrales Problem. In Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, ist der Jahrestag kein Thema.
Schulen behandeln das Massaker nicht, Denkmäler fehlen, wie die «Tagesschau» berichtet. Experten wie der Journalist Aleksandar Trifunovic betonen, dass die gesellschaftliche und wissenschaftliche Aufarbeitung in der Region kaum stattfindet.
Anhaltende Folgen für Überlebende
Die internationale Gemeinschaft habe es versäumt, die Aufarbeitung mit Nachdruck einzufordern, so die «Tagesschau».

Für die Überlebenden wie Nedzad Avdic bleibt das Leben schwer. Er sagt, dass die Leugnung des Genozids seine Identität und die seiner Kinder bedroht.
Solange die Vergangenheit nicht anerkannt werde, bleibe die Wunde offen, berichtet «Amnesty International».
Internationale Verantwortung und Mahnung
Fast 50 Verantwortliche wurden bislang zu mehr als 700 Jahren Haft verurteilt, wie «Euronews» berichtet. Die Erinnerung an Srebrenica mahnt Europa und die Welt, Minderheiten besser zu schützen.
Die Aufarbeitung des Genozids in Srebrenica ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Stimmen der Überlebenden und Angehörigen fordern weiterhin Wahrheit und Gerechtigkeit.