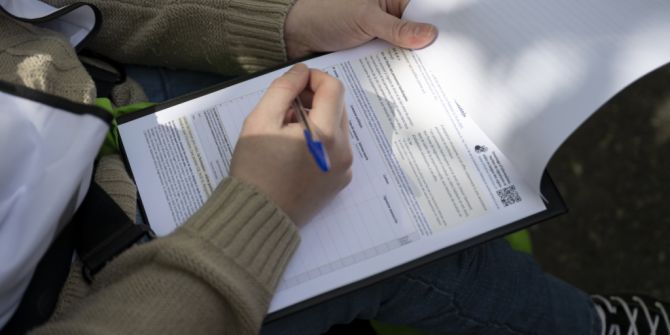Touristin gibt 130 statt 121 Fr. – und erntet bösen Blick
Die Amerikanerin fühlte sich trotz neun Franken Extra wie ein Geizhals. Wie viel Trinkgeld ist in der Schweiz normal? Experten klären auf.

Das Wichtigste in Kürze
- Eine Touristin gab neun Franken Trinkgeld und fühlte sich dennoch schräg angesehen.
- In der Schweiz ist Trinkgeld freiwillig – es gilt als Zeichen der Wertschätzung.
- Experten beantworten die wichtigsten Fragen zum Trinkgeldverhalten in der Schweiz.
Die US-Touristin zeigt sich verwirrt über die Trinkgeldsitten in der Schweiz. «Mein Mann und ich haben gelesen, dass man hier das Trinkgeld aufrundet», schreibt sie auf Reddit. Zweimal sei das gut gegangen – das Servicepersonal habe sich dankbar gezeigt.
Doch beim dritten Restaurantbesuch lief es anders: Auf eine Rechnung von 121 Franken legte das Paar 130 hin – und erntete dennoch einen missbilligenden Blick der Kellnerin. «Sie gab uns das Gefühl, dass es nicht genug war», so die Touristin ratlos.
Muss man hierzulande Trinkgeld geben? Wie viel ist angemessen? Ist gar kein Trinkgeld besser als ein paar Rappen? Hinsichtlich «korrektem» Trinkgeldverhalten herrschen offenbar noch immer Unsicherheiten – gerade bei ausländischen Gästen.
Zeit also, die wichtigsten Fragen von Fachleuten klären zu lassen!
Muss man in der Schweiz überhaupt Trinkgeld geben?
Trinkgeld ist hierzulande keine Pflicht. «In der Schweiz gilt seit 1974 ‹Service inbegriffen›. Trinkgelder sind daher offiziell kein Lohnbestandteil mehr», erklärt Patrik Hasler-Olbrych. Er ist Direktor ad interim von Gastrosuisse.
Wer dennoch etwas gibt, tut dies freiwillig: Trinkgeld habe «Schenkungscharakter» und sei ein Zeichen der Wertschätzung für guten Service.
Wie hoch ist ein übliches Trinkgeld?
Ganz klare Regeln gibt es nicht. Viele Gäste orientieren sich aber an Prozentwerten.
In einer GFS-Studie vom Juni 2022 gab ein Drittel an, etwa zehn Prozent Trinkgeld zu zahlen. 17 Prozent der Befragten schlagen ungefähr fünf Prozent auf die Rechnung.
Weitere 16 Prozent runden den Betrag auf den nächsten Franken auf, elf Prozent auf den nächsten Zehnfrankenbetrag.
War die 130-Franken-Gabe auf eine 121-Franken-Rechnung zu wenig?
Sébastien Fernandez, der an der EHL Hospitality Business School in Lausanne unter anderem zu Trinkgeldverhalten forscht, sagt klar: nein.
«Das ist ein durchaus grosszügiges Trinkgeld und absolut im Rahmen. Auf keinen Fall ein schlechtes Trinkgeld!»
Wer erhält das Trinkgeld eigentlich?
Nicht immer landet es direkt bei der bedienenden Person. In fast der Hälfte der Betriebe werden die Zusatzeinnahmen unter dem ganzen Team aufgeteilt (inkl. Küchenpersonal). Das zeigt eine Mitgliederumfrage von Gastrosuisse.
Lediglich ein Fünftel gab an, dass das Servicepersonal das Trinkgeld behält.

Was die Umfrage ebenfalls zeigt: In Hotels profitiert besonders häufig die gesamte Belegschaft von den Trinkgeldeinnahmen.
In Bars, Pubs und Diskotheken wiederum behält der Service in zwei Dritteln der Fälle das gesamte Trinkgeld.
Wo wird in der Schweiz am häufigsten Trinkgeld gegeben?
Am spendabelsten zeigen sich Gäste dort, wo sie direkt bedient werden.
Laut einer Umfrage im Auftrag von Gastrosuisse geben rund 58 Prozent in Restaurants, Hotels oder Cafés regelmässig ein Trinkgeld.
In Bars, Kinos oder Sportzentren sind es knapp 28 Prozent. Deutlich seltener bedanken sich Gäste in Selbstbedienungsrestaurants, Take-aways oder Foodtrucks (12 Prozent) sowie in Kantinen, Schulen oder Spitälern (acht Prozent).
Gibt es regionale Unterschiede?
Ja – vor allem zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz wird im Schnitt etwas häufiger Trinkgeld gegeben als in der Romandie oder im Tessin.
Deutsche zeigen sich zudem eher erkenntlich als Schweizer – und sind dabei auch grosszügiger. Das zeigt eine Studie, die Fernandez mitverfasst hat.

Auch die Zahlungsart spielt eine Rolle: In ländlichen Gegenden zahlen Gäste häufiger bar und geben damit auch öfter ein Trinkgeld.
Ist kein Trinkgeld besser als ein sehr kleines?
Fernandez stimmt zu. Ein Mini-Betrag könne rasch als negative Botschaft verstanden werden. Etwa, dass man mit dem Service unzufrieden war oder dem Personal demonstrativ wenig Anerkennung entgegenbringen möchte.
«Wenn Sie nichts geben, sendet das hingegen keine klare Botschaft», so Fernandez. Es könne schlicht bedeuten, dass man nicht zu den Gästen gehört, die Trinkgeld geben.

Der Experte rät deshalb: Entweder man rundet wie üblich auf, etwa auf fünf Franken, wenn der Kaffee 4.80 Fr. kostet. Oder man bedankt sich mit einem etwas grösseren Betrag, wenn man besonders zufrieden ist.
«Für mich wäre ein besser als erwartetes Trinkgeld zum Beispiel ein Franken für einen Kaffee. Oder zehn Franken für ein Abendessen unter hundert Franken.»
Wie verändert sich die Trinkgeldkultur?
Der Trend zu bargeldlosen Zahlungen hat Spuren hinterlassen. «Die Leute geben seltener Trinkgeld», stellt Fernandez fest.
Dafür sieht er zwei Hauptgründe: «Erstens denken viele Kunden schlicht nicht daran.» Das könne sich zusätzlich verstärken, wenn die Bedienung auf dem Kartengerät die Frage «Möchten Sie Trinkgeld geben?» überspringt.
«Zweitens sind sich manche Gäste unsicher, wie sie vorgehen sollen, und ob das Trinkgeld tatsächlich beim Servicepersonal ankommt.»
Die Zahlungsmethode verändert die Höhe des Trinkgelds indes kaum: Wer etwas gibt, bleibt in etwa bei denselben Beträgen wie beim Barzahlen.