Die 6 grössten Mythen über Lügner
«Lügen haben kurze Beiene»: Den Spruch kennen wir doch alle. Doch welche Mythen übers Lügen stimmen und welche sind nur gelogen? Wir verraten es.

Es gibt zahlreiche Mythen und Geschichten darüber, wie sich Lügner verhalten. Jeder von uns hat schon mal davon gehört – «Lügen haben kurze Beine» oder «Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ...»
Aber ist da mehr als die heimliche Drohung (du sollst nicht lügen) dran? Die sechs gängigsten Annahmen hier auf dem Prüfstand.
Mythos 1: Überzeugungen basieren auf Fakten
Eine weit verbreitete Meinung ist, dass Überzeugungen vor allem auf Fakten beruhen. Tatsächlich spielen jedoch Gefühle eine viel grössere Rolle dabei.
Menschen glauben das, was sie für wahr halten – unabhängig davon, ob es dafür Beweise gibt oder nicht. Einmal gefestigte Ansichten lassen sich denn auch nur schwer ändern.

Gleichzeitig wird unterschätzt, wie stark emotionale Faktoren sowohl die Täuschung als auch die Entlarvung prägen: Lügner nutzen kognitive Empathie, um die Erwartungen ihres Gegenübers gezielt zu bedienen, während unschuldige Personen in Befragungssituationen oft stressbedingte Emotionen zeigen, die fälschlich als Schuldindikatoren gewertet werden.
Mythos 2: Vertraute Personen lügen uns nicht an
Viele Menschen gehen davon aus, dass ihnen nahestehende Personen – Familienmitglieder oder enge Freunde – niemals etwas vormachen würden. Wir entwickeln interpersonales Vertrauen bereits in der Kindheit durch wiederholte positive Erfahrungen, die das Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit prägen.

Dieses generalisierte Vertrauen führt dazu, dass wir nahestehenden Personen grundsätzlich Wahrhaftigkeit unterstellen, um Beziehungen so angenehm wie konfliktarm zu gestalten.
Der Glaube an die Ehrlichkeit von Angehörigen dient als mentale Abkürzung, um komplexe soziale Interaktionen zu vereinfachen. Gleichzeitig wird die Angst vor Betrug verdrängt, da Misstrauen emotional belastend ist und Beziehungen destabilisieren kann.
Mythos 3: Lügen fliegen immer auf
Mythen über das Aufdecken von Lügen sind oft vereinfachend. Die Behauptung «Lügen fliegen immer auf» ist nicht universell wahr, im Gegenteil: Viele Lügen bleiben verborgen, besonders wenn sie wenig Konsequenzen haben oder isoliert auftreten.
Lügen mit hohen Risiken oder komplexen Folgen werden eher aufgedeckt, etwa durch Widersprüche oder forensische Beweise. Systematisches Lügen in Machtpositionen kann jedoch jahrelang unerkannt bleiben, wenn Kontrollmechanismen versagen.
Menschen überschätzen zudem oft ihre Fähigkeit, Lügen zu erkennen, was den Mythos nährt. Gleichzeitig begünstigen kognitive Verzerrungen wie der «Truth Bias» (Glaube an Ehrlichkeit), dass Unwahrheiten übersehen werden.
Mythos 4: Lügner können einem nicht in die Augen schauen
Ein gängiger Mythos besagt auch, dass Lügner den Blickkontakt vermeiden würden. Untersuchungen zeigen jedoch: Das stimmt so nicht.

Es gibt keinen zuverlässigen Zusammenhang zwischen Blickrichtung oder Augenkontakt und dem Wahrheitsgehalt einer Aussage. Weder das angebliche «Blick-nach-rechts-oben» noch das Vermeiden von Augenkontakt gelten als sichere Indikatoren.
Vermeidung von Augenkontakt wird zwar oft als Lügen-Signal interpretiert, kann aber ebenso auf Scham oder Ablenkung hinweisen. Tatsächlich setzen manche Lügner sogar bewusst intensiven Blickkontakt ein, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen.
Mythos 5: Lügner haben eine bestimmte Körpersprache
Lügner zeigen oft spezifische körperliche Reaktionen, die mit Stress oder Anspannung verbunden sind. Dazu gehören vermehrte Berührungen im Gesicht, nervöse Handbewegungen oder ein trockener Mund, der zu häufigem Schlucken führt.
Lügende neigen zu zurückweichenden Positionen, etwa durch eine nach hinten geneigte Oberkörperhaltung oder Füsse, die unbewusst zur Fluchtrichtung ausgerichtet sind. Gleichzeitig wirken Gesten oft unnatürlich reduziert, da die kognitive Belastung des Lügens die Koordination von Sprache und Körpersprache erschwert.
Kein einzelnes Signal beweist eine Lüge, da Stressreaktionen auch durch andere Faktoren ausgelöst werden können. Eine verlässliche Einschätzung erfordert immer die Analyse von Sprachmustern, situativem Kontext und mehreren körpersprachlichen Hinweisen gleichzeitig.
Mythos 6: Lügner fühlen Schuld und Reue
Schliesslich wird oft geglaubt, dass Lügen zwangsläufig von Gefühlen der Schuld begleitet werden. Aber das trifft längst nicht auf alle Lügner zu – insbesondere dann nicht, wenn sie sehr geübt im Täuschen sind.
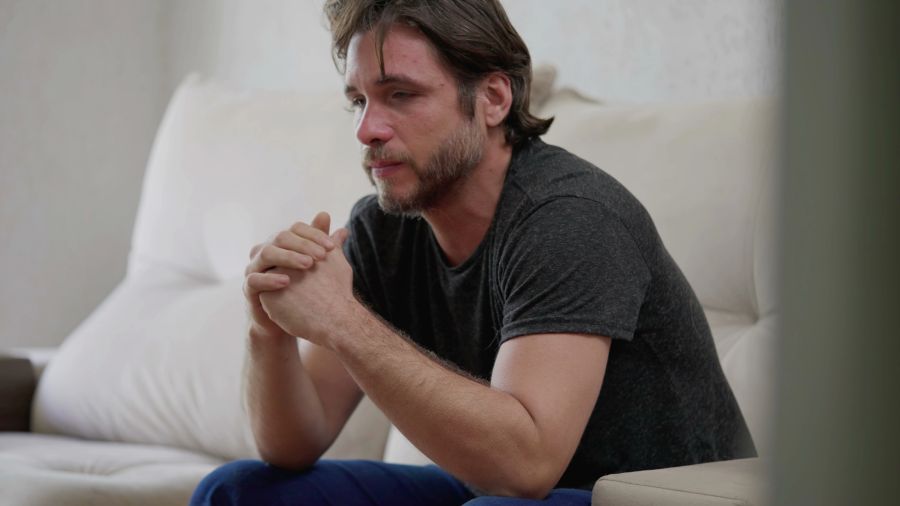
Speziell bei pathologischem Lügen (Pinocchio-Syndrom) setzt Reue oft erst nach gravierenden Konsequenzen ein. Beispielsweise, wenn Beziehungen zerbrechen oder Depressionen entstehen.
Auch bei narzisstischen oder machiavellistischen Persönlichkeiten dominieren eher Manipulation und Selbstschutz. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl hingegen fühlen tatsächlich oft Scham.






