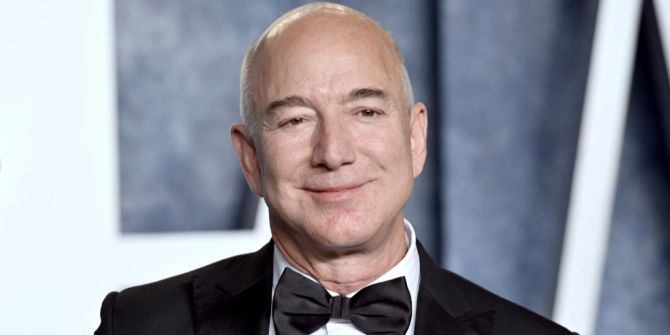Wiener Volksoper arbeitet eigene NS-Vergangenheit auf
Das Stück soll an jene Künstlerinnen und Künstler erinnern, die wegen ihrer jüdischen Herkunft vertrieben oder ermordet wurden. Wie gelingt das?

Die Volksoper Wien hat sich für eine ungewöhnliche Form der Geschichtsaufarbeitung entschieden. Mit der Uraufführung der Operette «Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938» erinnerte die Bühne an jene Künstlerinnen und Künstler des Hauses, die im Zuge der NS-Verfolgung wegen ihrer jüdischen Herkunft vertrieben oder ermordet wurden.
Der niederländische Regisseur Theu Boermans baute ein Stück im Stück rund um die letzte Operettenproduktion, die 1938 kurz vor dem «Anschluss» Österreichs an Nazi-Deutschland an der Volksoper neu produziert worden war. Dieses Werk trug den Titel «Gruss und Kuss aus der Wachau» und stammte aus der Feder des Komponisten Jara Benes.
Boermans lässt das Publikum an den damaligen Proben zu dieser leichten Heirats- und Liebesgeschichte teilhaben, und an den verschiedenen Reaktionen, die der Nationalsozialismus unter den Künstlern der Volksoper auslöste – von Begeisterung und Mitläufertum bis hin zur Solidarität mit den jüdischen Kollegen, die fliehen mussten oder deportiert wurden.
Viel Applaus fürs Ensemble
Die israelische Keren Kagarlitsky setzte als Komponistin und Dirigentin musikalische Kontraste, indem sie für die Neuproduktion «Lass uns die Welt vergessen» die teils jazzigen Melodien von Jara Benes mit eigener Musik und mit Werken von Schönberg und Mahler kombinierte.
Das Publikum liess sich von Kagarlitskys Leistung und von Boermans' Erzählung berühren. Viel Applaus gab es für das heutige Ensemble, welches das künstlerische Volksopern-Team des Jahres 1938 noch einmal zum Leben erweckte.
Darunter war damals etwa auch Fritz Löhner-Beda, der nicht nur als Librettist der Lehar-Operette «Land des Lächelns» bekannt ist, sondern auch als Texter des «Buchenwaldliedes», das er im gleichnamigen Konzentrationslager schrieb. Er wurde 1942 im KZ Auschwitz ermordet.