Coming-out: Wenn das Gefühl des Andersseins zur Zerreissprobe wird
Anlässlich des Coming-out-Days hat die Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf eine Kampagne lanciert. Dadurch soll der Diskurs zur Thematik angeregt werden.

Am 11. Oktober 2020 fand der internationale Coming-out-Day statt. Im Kern geht es beim Aktionstag darum, ungeouteten Personen beim eigenen Coming-out Mut zu machen.
Auch die Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf (KJAD) hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Leiterin Cristina Rampin erklärt, welche Schritte bei einem Coming-out durchlaufen werden und wie das KJAD-Team Unterstützung anbietet.
Nau.ch: Welche Rolle spielt die Genderthematik bei der Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf?
Cristina Rampin: Für das KJAD-Team ist die Genderthematik ein zentrales Thema, das konstant im Alltag bearbeitet und angesprochen wird.
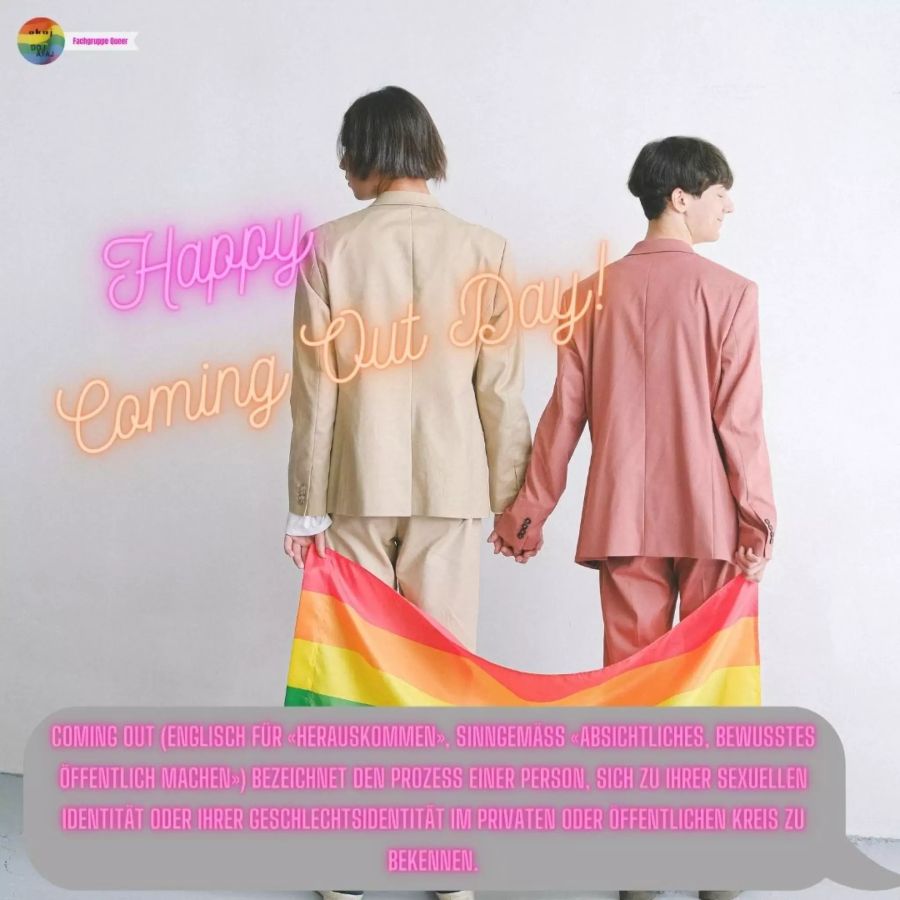
Das Thema Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, vor allem nicht die heteronormativen Lebensweisen, werden von Jugendlichen und Kindern täglich aufgenommen. Das Wort «schwul» wird in der Jugendsprache oft angewendet, um etwas als komisch oder unpassend zu deklarieren.
Diese Umdeutung kann eine homophobe Haltung suggerieren, obwohl dies von vielen gar nicht so gemeint ist. Dieser Umstand gibt uns viele Möglichkeiten Diskussionen über Geschlechtsidentität und Coming-out zu führen.
Nau.ch: Wie wurde der Coming-out-Day bei der Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf thematisiert?
Extra zum Coming-out-Day lancierten wir eine Kampagne, in der wir über unseren Instagram- und Facebook-Kanal entsprechende Bilder mit kurzen Texten verbreiteten. Im Jugendhaus sind die Kampagnenbilder ausgehängt und fördern so den Diskurs zum Coming-out-Day.
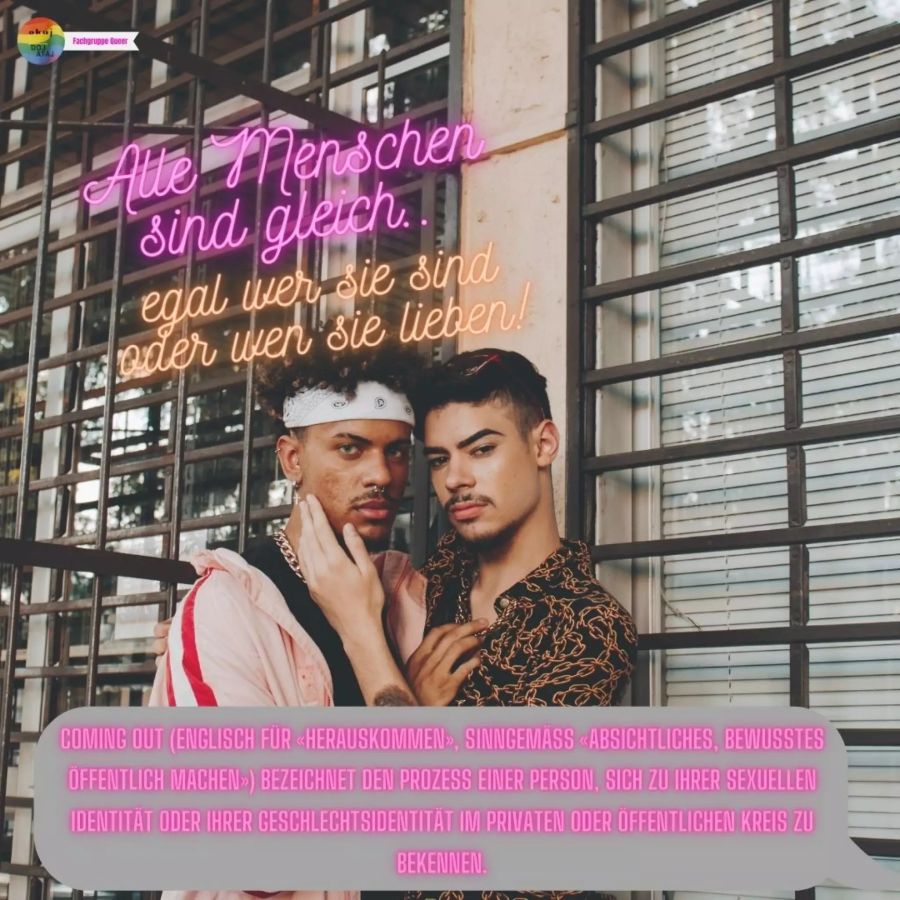
Zudem gibt es im Jugendhaus diverses Infomaterial zum Thema. Als Beispiel liegen das Milchbüechli-Magazin prominent auf.
Nau.ch: Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Hürden, die Jugendliche bei einem Coming-out zu bewältigen haben?
Cristina Rampin: Das Coming-out ist ein Prozess, der oft mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Es werden dabei verschiedene Phasen durchlaufen. Die ersten Prozessschritte werden oft ohne Unterstützung allein gegangen.
Gleichgesinnte oder unterstützende Personen sind meist noch nicht bekannt oder erreichbar. Die heteronormative Gesellschaft verunsichert dabei und es kommt nicht selten zu grundsätzlichen und existenziellen Fragen.
Das Gefühl des Andersseins kann zur Zerreissprobe werden und widerspricht der erlernten und erwarteten Rollenanforderungen.
Die Suizidalität von Kindern und Jugendlichen, die sich nicht hetero zuordnen, ist bedeutend höher als der Durchschnitt der gleichaltrigen Heterojugendlichen. Daran kann erkannt werden, wie gross der Leidensdruck bei Personen im Coming-out Prozess werden kann.

Das äussere Coming-out, mit dem die Mitmenschen informiert werden, ist eher dem Ende des Prozesses zugeordnet. Kontakte zu unterstützenden Personen oder Gruppen bestehen dann oft schon und helfen enorm.
Dabei exponiert man sich erneut und muss leider immer noch mit Ausgrenzung, Blossstellung und Gewaltanwendungen rechnen. Dies kann wiederum einen Rückschritt auslösen, welcher von Schamgefühl, Isolation und Depression charakterisiert ist.
Nau.ch: Wie unterstützen Sie Jugendliche in dieser Zeit?
Cristina Rampin: Das Jugendhaus und seine Mitarbeitenden signalisieren proaktiv ihre nicht heteronormative Haltung. Jugendliche und Kinder, die in diesem Prozess stehen, nehmen solche Signale auf.
Sie erkennen damit, dass sie nicht allein sind und im Jugendhaus auf Verständnis und Hilfsbereitschaft treffen. Zudem sensibilisieren wir auch alle nicht betroffenen Jugendlichen und Kinder durch unsere Haltung und Signalethik.

Die Sichtbarkeit eines Regenbogen Klebers ermöglicht tägliche Gespräche zur Thematik, die von Kindern und Jugendlichen angeregt werden.
Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu selbstbestimmten und selbstwirksamen Persönlichkeiten ist eines der wichtigsten Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.






