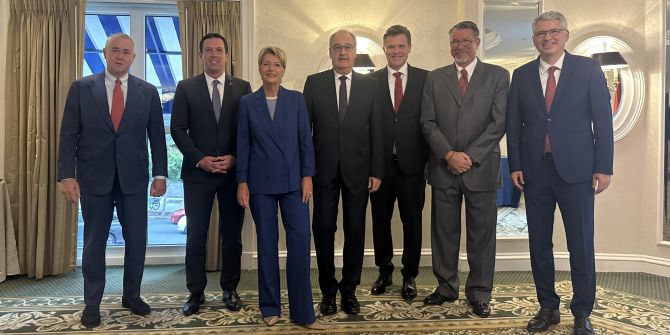Kreislaufwirtschaft birgt viel Potential
Rohstoffe werden immer knapper. Gerade für die Schweiz als ressourcenarmes Land hat die Kreislaufwirtschaft deshalb grosses Potenzial.

Das Wichtigste in Kürze
- Aktuell landen viele Güter nach dem Gebrauch in der Kehrichtverbrennung - und mit ihnen wichtige Rohstoffe.
Bisher wird dieses aber nur von einem Bruchteil der Schweizer Unternehmen genutzt. Aktuell landen viele Güter nach dem Gebrauch in der Kehrichtverbrennung – und mit ihnen wichtige Rohstoffe.
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft will deshalb bestehende Ressourcen effizienter nutzen, um diese im Umlauf zu halten.
Aber erst etwa 10 Prozent der Schweizer Unternehmen engagieren sich «substanziell» in der Kreislaufwirtschaft, hielten die Konjunkturforscher der ETH (KOF) und die Berner Fachhochschule (BFH) Ende 2021 in einer Studie fest. Viele Unternehmen hätten das Thema bisher noch kaum auf dem Radar, so das Fazit.
«Will die Schweiz künftig noch wettbewerbsfähig sein, muss sie effizienter mit den vorhanden Ressourcen umgehen», sagte Studienautor Tobias Stucki im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Stucki ist Leiter des Instituts Sustainable Business an der BFH.
Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse betont, dass die Kreislaufwirtschaft den Unternehmen Wettbewerbsvorteile bringen kann. «Die Wiederverwendung von Rohstoffen kann zudem zu Kosteneinsparungen führen», sagt Alexander Keberle, Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt beim Verband.
Um das Potential der Kreislaufwirtschaft vollends auszuschöpfen, braucht es gemäss Stucki Druck von Seiten der Politik. «Auf politischer Ebene müssen nun die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um eine dauerhafte Verbesserung der Ressourceneffizienz zu erreichen», heisst es auch von Seiten Economiesuisse.
Der Bundesrat hatte im März erste Pläne bekanntgegeben, wie er die Kreislaufwirtschaft stärken will. In einem ersten Schritt soll aufgezeigt werden, wo Potentiale bestehen und welche Gesetze, Verordnungen und Reglemente die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft behindern. Insbesondere im Bausektor und in der Ernährungswirtschaft will der Bundesrat den Rohstoffverbrauch verbessern.
Stucki zufolge wäre die Schweiz für eine Vorreiterrolle in diesem Bereich prädestiniert. «Kreislaufwirtschaft ist letztendlich eine Form der Innovation und in der Schweiz wissen wir wie Innovation funktioniert. Gleichzeitig haben wir eine hohe Kaufkraft», sagt dieser. Keberle von Economiesuisse betont zudem, die Schweizer Wirtschaft habe durch Kreislaufwirtschaft das Potential, einen Reputationsgewinn zu erzielen.
Die wichtigsten Pfeiler der Kreislaufwirtschaft sind die «drei R» – reduce (reduzieren), reuse (wiederverwenden), recycle (rezyklieren). Verschiedene Firmen haben deren Anwendung bereits in ihrer Firmenphilosophie verankert. Nachfolgend einige Beispiele.
Hier geht es in erster Linie darum, weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Einen grossen Hebel hat die Bauindustrie. Auf diese entfällt gemäss dem Bundesamt für Umwelt mit 84 Prozent der grösste Anteil der Schweizer Abfallmenge.
Um dem entgegenzuwirken, stellt der Bauchemikalienhersteller Sika zum Beispiel diverse Produkte bereits zu einem Grossteil aus nachwachsenden Rohstoffen her. Für ein Fliessmittel, das zur Herstellung von Beton verwendet wird, wurden beispielsweise über 80 Prozent der ölbasierten Rohstoffe durch nachwachsende pflanzliche Stoffe ersetzt, die als Abfall bei der Zuckerproduktion anfallen.
Der weltgrösste Zementhersteller Holcim stellt auch einen «grünen» Beton namens Ecopact her. Je nach Produkt enthält dieser bis zu 95 recycelte Rohstoffe. Bis 2025 will Holcim damit ein Viertel des Transportbetonumsatzes generieren.
Mittlerweile hat der Zementkonzern über eine Million Kubikmeter des «grünen» Betons verkauft. Zum Vergleich: 2021 hatte der Konzern gesamthaft 46,5 Millionen Kubikmeter Transportbeton abgesetzt. Auch der Zement von Holcim besteht zu einem Fünftel aus Bau- und Abbruchabfällen.
Die, die bauen lassen, engagieren sich ebenfalls: Mit einem Projekt an der Müllerstrasse in Zürich will der Schweizer Immobilienriese SPS das Potential der Kreislaufwirtschaft aufzeigen. Das bestehende Gebäude wird nicht abgerissen, sondern bis auf die Tragstruktur rückgebaut und dann mit neuer Fassade, Dach und Technik versehen. Die abgebauten Materialien werden wenn möglich wiederverwendet. Bei der Fassade seien dies bis zu 80 Prozent.
Auch in der Industrie ist es möglich, Bestandteile wiederzuverwerten. Der Maschinenbauer Bystronic etwa setzt bereits seit einigen Jahren auf modulare Maschinen. «Dadurch können einzelne Bauteile über unseren Service einfacher und schneller vor Ort ausgetauscht werden», teilt ein Sprecher von Bystronic mit.
Hat eine Maschine nach 10 bis 15 Jahren trotz Reparaturen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, wird sie in einem Aufarbeitungszentrum von Bystronic überholt. Dadurch wird für die «neue» Maschine nur 2 Prozent neues Material verwendet. 2021 hat Bystronic in den Aufarbeitungszentrum 90 Anlagen wieder auf Vordermann gebracht.
Am Ende gibt es aber immer wieder Bestandteile, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Anstatt dass diese aber in der Kehrichtverbrennung landen, setzt die Kreislaufwirtschaft auf Recycling. Beispielsweise hat der Baustoffkonzern Holcim im vergangenen Jahr über 50 Millionen Tonnen Material rezykliert. Diese Menge soll bis 2030 gar verdoppelt werden. Ein Teil davon wird dann zu umweltfreundlichen Baulösungen verarbeitet.
Diese Beispiele zeigen verschiedene Wege, das Thema Kreislaufwirtschaft anzugehen. Aber für grosse Unternehmen ist es einfacher, das System der zirkulären Wirtschaft zu erschliessen als für KMU. Zu diesem Schluss kommt auch die Studie von KOF und BFH.
«Der Veränderungsdruck ist bei den sehr grossen Unternehmen oftmals höher», erklärt Martin Wörter, Professor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH, ebenfalls ein Autor der Studie. Zudem mangle es bei den kleinen Unternehmen häufiger am notwendigen Know-how.